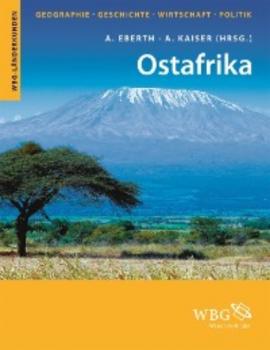Группа авторов
Список книг автора Группа авторовDeutschsprachige Schriftstellerinnen des Fin de siècle
Die Literatur der Jahrhundertwende lässt sich aufgrund der Vielfalt der literarischen Produktion und poetologischen Programmatik nicht auf einen Epochenbegriff bringen, doch in einem Punkt sind sich sogar widerstreitende Literaturhistoriker einig: Für sie lag die Literaturproduktion um 1900 (1880 – 1914/18) ausschließlich in männlicher Hand. Schriftstellerinnen werden entweder gar nicht oder nur beiläufig erwähnt, mit Ausnahme von Ricarda Huch, gelegentlich Gabriele Reuter und in Verbindung mit Nietzsche und Rilke Lou Andreas-Salomé. Während die Literatur von Frauen um 1900 von der zeitgenössischen Kritik als aktuell und innovativ gewürdigt wurde, sind die Autorinnen aus dem bestehenden literarischen Kanon weitestgehend ausgeschlossen. Dieses Buch versteht sich nicht zuletzt auch als Plädoyer dafür, ihnen einen angemessenen Platz in der modernen Literaturgeschichtsschreibung einzuräumen. Außerdem möchte es dazu anregen, die zu Unrecht vergessenen Schriftstellerinnen des Fin de Siècle wieder zu entdecken und ihre Werke neu zu lesen.
Ostafrika
Ostafrika – mit den Ländern Tansania, Kenia, Uganda, Ruanda und Burundi – ist eine der dynamischsten Regionen der Erde, und dies nicht nur im Hinblick auf das wirtschaftliche Wachstum. Investitionen aus dem Ausland fördern einen Aufschwung und bringen moderne Entwicklungen – nicht immer handelt es sich dabei allerdings um nachhaltige Entwicklungen. Zudem bekommen nur wenige Regionen die Einflüsse des Klimawandels ähnlich deutlich zu spüren wie das östliche Afrika. Fundiert, reich illustriert und mit aktuellen Landkarten, Grafiken und Tabellen versehen, bietet dieses Buch eine Fülle von gut aufbereiteten Informationen zu dieser vielfältigen und spannenden Region. Von den naturräumlichen und klimatischen Bedingungen über die wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklungen bis hin zu den kulturellen und gesellschaftlichen Besonderheiten der einzelnen Länder decken die Autoren alle Bereiche ab, die eine moderne Länderkunde ausmachen.
Die Weltreligionen und wie sie sich gegenseitig sehen
Wie bewertet der Islam das Christentum? Welche Gemeinsamkeiten existieren zwischen Judentum und Buddhismus? Inwiefern rezipierten hinduistische Gelehrte die Bibel? Wie sahen und sehen sich die Religionen gegenseitig? Wo berühren sie sich in ihrem Glauben oder in ihren heiligen Schriften? Und wo liegen unüberbrückbare Unterschiede?
Der vorliegende Band befasst sich mit der wechselseitigen Wahrnehmung der fünf Weltreligionen: Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt dabei auf dem Christentum, das dementsprechend in Katholizismus, Protestantismus und Orthodoxie gegliedert ist.
In sieben Kapiteln erfährt der Leser, wie sich der wechselseitige Blick historisch entwickelte, in welchen Institutionen sich der Dialog zwischen den Religionen manifestiert, und wie sich der Alltag des interreligiösen Zusammenlebens in verschiedenen Ländern und Kontinenten bis heute gestaltet.
Mit Beiträgen von: Johann Figl, Vasilios Makrides, Ulrich Dehn, Gianfranco Miletto, Monika Tworuschka, Andreas Nehring, Frank Usarski, Rafal Shoji u. a.
Hitlers militärische Elite
Bei der Ausführung seiner verbrecherischen Eroberungs- und Kriegspläne konnte Hitler mit einer großen Gruppe militärischer Funktionsträger rechnen, die seine Politik unterstützten und mehr oder weniger bereitwillig umsetzten. Wer waren diese Männer, die zu Hitlers militärischer Elite zählten? Wie weit stellten sie sich jeweils in den Dienst des nationalsozialistischen Staates? In diesem Sammelwerk porträtieren namhafte Historiker die Karrieren und Verstrickungen führender Militärs im Dritten Reich. Vorgestellt werden nicht nur die prominenten Heerführer, sondern auch Offiziere aus der Luftwaffe und der Marine, Militärärzte, Militärjuristen und Führer der Waffen-SS.
Mit Beiträgen u.a. über Generaloberst Johannes Blaskowitz, Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, Generalfeldmarschall Fedor von Bock bis zu Generalmajor Henning von Tresckow, General der Artillerie Walter Warlimont, Generalfeldmarschall Maximilian Freiherr von und zu Weichs an der Glon und Generaloberst Kurt Zeitzler.
Pluralistische Identität
Der Begriff des Abendlandes erlebt derzeit, so scheint es, eine Renaissance – vor allem als Chiffre für eine einheitliche, epochen- und länderübergreifende, tendenziell von außen (und von zuviel Pluralität) gefährdete europäische Identität. Pluralität und Identität geraten dabei leicht in eine strikte Gegensatzperspektive, die, wie der vorliegende Forschungsband zeigt, dem historischen wie dem aktuellen Befund nicht gerecht wird. Kulturell hat Europa plurale, nämlich griechische, römische und christlich-jüdische Wurzeln, und immer neue Aushandlungsprozesse haben durch die Jahrhunderte hindurch seine Identitätsbildung geprägt. Politisch hat sich die Vielfalt in Europa stets neben den universalistischen Einheitskonzepten behauptet. Heute gehört die funktionierende Pluralität unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse, Weltanschauungen und persönlicher Lebensentwürfe zu den unverzichtbaren Markenzeichen der europäischen Identität.
Europa
Europa ist ein grandios reicher Kulturraum mit einer überwältigend vielfältigen Geschichte. Seit Ende des 15 Jh.s haben die Europäer begonnen, die Welt zu entdecken, sie zu unterwerfen und auszubeuten. In der Welt wird Europa vielfach bewundert, selbst fühlt es sich in einer Krise – all das ist Europa. Die unterschiedlichsten Aspekte europäischer Identitätsgeschichte analysieren nun über 100 Weltbürger: Historiker und Intellektuelle aus Frankreich und Deutschland, Italien, England, aber auch aus den USA, Indien oder Japan. Entstanden ist eine unvergleichliche Geschichte Europas, ein Riesenmosaik der Erinnerungsorten, von der Nymphe Europa bis Tschernobyl, vom Hadrianswall bis zur Berliner Mauer, von der Kalaschnikow bis zum VW-Käfer, von Demokratie bis Holocaust. Der Leser wird mitgenommen auf eine Reise durch Völkerkunde und Archäologie, durch Religion und Politik, durch Volkswirtschaft, Kunst und Kochkunst. Noch nie wurde Europa einer solch umfassenden Befragung unterzogen wie in diesem Großwerk. Was macht Europa aus? Hier finden Sie die Antwort.
Band 1: Lebendige Vergangenheit, mitherausgegeben von Akiyoshi Nishiyami u. Valérie Rosoux; Band 2: Europa im Plural, mitherausgegeben von Pierre Monnet und Olaf B. Rader; Band 3: Globale Verflechtungen, mitherausgegeben von Jakob Vogel.
Europa
Europa ist ein grandios reicher Kulturraum mit einer überwältigend vielfältigen Geschichte. Seit Ende des 15 Jh.s haben die Europäer begonnen, die Welt zu entdecken, sie zu unterwerfen und auszubeuten. In der Welt wird Europa vielfach bewundert, selbst fühlt es sich in einer Krise – all das ist Europa. Die unterschiedlichsten Aspekte europäischer Identitätsgeschichte analysieren nun über 100 Weltbürger: Historiker und Intellektuelle aus Frankreich und Deutschland, Italien, England, aber auch aus den USA, Indien oder Japan. Entstanden ist eine unvergleichliche Geschichte Europas, ein Riesenmosaik der Erinnerungsorten, von der Nymphe Europa bis Tschernobyl, vom Hadrianswall bis zur Berliner Mauer, von der Kalaschnikow bis zum VW-Käfer, von Demokratie bis Holocaust. Der Leser wird mitgenommen auf eine Reise durch Völkerkunde und Archäologie, durch Religion und Politik, durch Volkswirtschaft, Kunst und Kochkunst. Noch nie wurde Europa einer solch umfassenden Befragung unterzogen wie in diesem Großwerk. Was macht Europa aus? Hier finden Sie die Antwort.
Band 1: Lebendige Vergangenheit, mitherausgegeben von Akiyoshi Nishiyami u. Valérie Rosoux; Band 2: Europa im Plural, mitherausgegeben von Pierre Monnet und Olaf B. Rader; Band 3: Globale Verflechtungen, mitherausgegeben von Jakob Vogel.
Rückenwind für den Papst
Papst Franziskus steht seit seinem Schreiben »Amoris laetitia« über die Liebe in der Familie kirchenintern in der Kritik. Auf die Attacken gegen den Papst und das nachsynodale Schreiben reagiert die am 16.10.2017 gestartete internationale katholische Initiative »Pro Pope Francis« um den Wiener Pastoraltheologen Paul Zulehner und den tschechischen Soziologen und Religionsphilosophen Tomáš Halík, die den Papst öffentlich unterstützt. Sie steht für eine pastorale Kultur, die sich an der Barmherzigkeit orientiert, für einen Weg, den die Kirche zusammen mit ihrem Papst einschlagen möge. Der vorliegende Debattenband versammelt die Stellungnahmen wichtiger Kirchenvertreter, Ordensleute, Theologen, Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens, Spiritueller Begleiter und engagierter Laien.
Beiträger: Bischof Franz-Josef Overbeck, Gerda Schaffelhofer, Alois Glück, Eva-Maria Faber, Margit Eckholt, Anselm Grün, Christian Bauer, Klaus Lüdicke, Hubert Wolf, Rita Süssmuth.
Analytische Religionsphilosophie
Die analytische Religionsphilosophie ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum universalen Medium des philosophischen Diskurses geworden das auch im deutschsprachigen Raum stetig größeren Einfluss gewinnt. Die analytische Religionsphilosophie zeigt neue Wege der Interpretation von Themen der klassischen natürlichen Theologie unter Berücksichtigung des modernen Weltbildes auf. Ihre Rezeption aktueller Entwicklungen in Logik, Wissenschafts- und Erkenntnistheorie hat ihr bislang ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, die rationale Begründung von Glaubensaussagen zu analysieren. Diese Anthologie versammelt zentrale Beiträge der letzten Jahre erstmals in deutscher Sprache. Die Texte führen in die Geschichte und das Selbstverständnis der analytischen Religionsphilosophie ein und stellen gegenwärtige Argumente und Entwicklungen im Feld der Gottesbeweise, der Interpretation seiner Attribute und dem Theodizeeproblem vor. Der Band bietet gleichzeitig eine gute Textgrundlage für Seminare.
Ermutigung zum Aufbruch
Inmitten einer Kirchenkrise geschieht das Unglaubliche: Mit Mut und Entschlossenheit kündigt Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil an. Er weiß, dass die Kirche ihre Botschaft den Menschen von heute nur noch dann vermitteln könne, wenn sie sich öffne, alle Fenster aufreiße und »einen Schritt vorwärts« wage. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) wird schließlich zu einem der herausragenden Ereignisse der modernen Kirchengeschichte. Es ist der Anfang eines notwendigen Aufbruchs, der der Kirche zu neuer Blüte verhelfen soll. 50 Jahre danach fragen renommierte Theologinnen und Theologen in diesem Buch, was vom Aufbruch bleibt. In kritischer Auseinandersetzung mit den Konzilsbeschlüssen zieht der Band Bilanz und verdeutlicht dem Leser, welchen Aufgaben sich die Kirche in heutiger Zeit noch stellen muss. Mit Beiträgen u. a. von Johannes Beutler SJ, Christoph Böttigheimer, Sabine Demel, Margit Eckholt, Gisbert Greshake, Hans-Jochen Jaschke und Peter Knauer SJ.