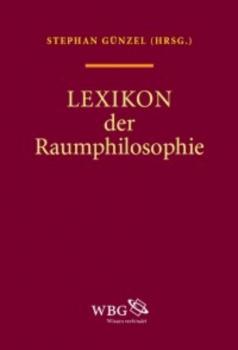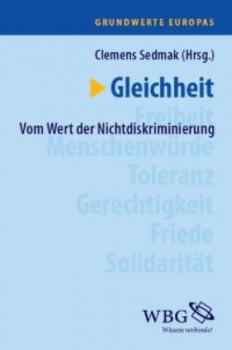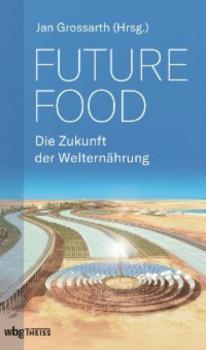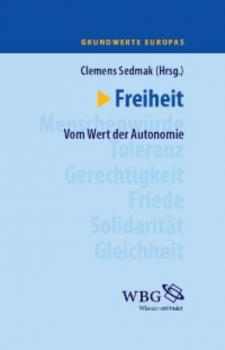Группа авторов
Список книг автора Группа авторовI have a dream.
„I have a dream“ – Visionen, Träume, Wille zur Veränderung und Aufbruchsdenken entgegen aller Stagnation spiegeln sich in den großen Reden von der Antike bis in unsere Zeit. Sei es der Aufruf Urbans II. zum Kreuzzug 1095, Martin Luther Kings Rede gegen die Rassendiskriminierung in den USA, die Rede Willy Brandts nach dem Fall der Mauer oder Barack Obamas Inaugural Address: Alle diese Reden haben viele Menschen bewegt, zum Handeln motiviert oder Ereignisse scharfsinnig kommentierend begleitet. Oft erlangten die in diesem Band vorgestellten Reden auch große literarische Bedeutung. Meist sind es jedoch einzelne prägnante Sätze, die bis in die Gegenwart nachhallen und noch heute unvergessen sind. 15 prägnante Beispiele bedeutsamer Redekunst von der Antike bis in die Gegenwart werden in diesem Band vorgestellt. Eine Einführung zu jeder Rede beleuchtet anschaulich die Persönlichkeit des Redners, die rhetorischen Besonderheiten und die Wirkung der Rede sowie den historischen Kontext.
Dem Entsetzen täglich in die Fratze sehen
Täglich erreichen uns Nachrichten von schier unüberwindbaren humanitären und politischen Krisen, von bewaffneten Konflikten, vom Aufschwung extremer Gruppen, von autokratischen Herrschsüchtigen und von tragischen Einzelschicksalen. Die Frage nach dem Warum drängt sich immer wieder auf. Warum sind wir Menschen so missgünstig? Warum so narzisstisch? Warum fürchten wir das Fremde so sehr? Wer entscheidet darüber, was böse ist und was gut? Hat sich die Vernunft erschöpft? Dieses Buch lässt zahlreiche Stimmen aus den Bereichen Philosophie und Geschichtswissenschaft, Politik und Medien, Bildende Kunst, Literatur und Musik, Theologie und Medizin dazu Stellung nehmen. Die Konfrontation mit dem Bösen ist das eine, die Herausforderung im Umgang mit ihm das andere und immer wieder auch die Erfahrung, dass wir ihm nicht wehrlos ausgeliefert sind. Mit Texten von Rüdiger Safranski, Herfried Münkler, Helmut Koopmann, Theo Elm, Antje Vollmer, Jens Jessen, Thomas Assheuer u.v.a.m.
Lexikon Raumphilosophie
Der Raum und das Verständnis des Raums sind als große neue Themen der Philosophie im Gespräch. Die damit zusammenhängenden Fragen gewinnen derart an Bedeutung, dass von einem ›spatial turn‹ der Wissenschaft gesprochen wird, in Entsprechung zum ›linguistic turn‹, der das Gesicht der Philosophie bereits komplett verändert hat. Dieses interdisziplinär angelegte Lexikon versammelt in rund 650 Einträgen die zentralen Begriffe, Personen und Theorien der aktuellen Raumforschung in den Natur- und Kulturwissenschaften sowie der Philosophie. Die Autoren aus den verschiedensten Disziplinen skizzieren in ihren Beiträgen präzise die Methoden, Theorien oder die Praxis ihres Faches. Die Artikel bieten einen schnellen Überblick über die jeweiligen Ansätze – unter Berücksichtigung der klassischen Vorläufer ebenso wie der aktuellen Forschungsliteratur. Zahlreiche Querverweise ermöglichen die Erarbeitung größerer Zusammenhänge.
Gleichheit
Der Begriff der Gleichheit gehört spätestens seit der Französischen Revolution zum europäischen Grundvokabular. Formen des Gleichheitsgedankens finden sich bereits in der stoischen Philosophie oder dem christlichen Denken. Die Erklärung der Menschenrechte im 20. Jahrhundert unterstreicht die Bedeutung dieses Begriffs, der in der jüngeren Geistesgeschichte untrennbar mit dem Begriff der ›Menschenwürde‹ verbunden ist. Aber ist ›Gleichheit‹ ein spezifisch europäischer Wert? Wie steht es um das Verständnis von Gleichheit in amerikanischen oder asiatischen Kulturen? Wie hat sich der Begriff der Gleichheit seit der Französischen Revolution in Europa gewandelt? Und: Wie viel Ungleichheit ist einer Gesellschaft zumutbar? Interdisziplinär angelegt bietet Band 3 der Reihe »Grundwerte Europas« Einblicke in diese Diskussion unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Kontextes sowie aktueller Debatten. Dabei werden die außereuropäischen Diskurse nicht aus dem Blick verloren.
Future Food - Die Zukunft der Welternährung
In Zukunft leben 9 Milliarden Menschen auf der Erde. Wie werden sie satt, ohne, dass der Planet kollabiert? Die Temperaturen steigen, Rohstoffe werden knapp, die Wüste wächst. Der Wettlauf zwischen Bevölkerungswachstum und Nahrungsmittelproduktion ist in vollem Gange. Dass künftig alle genügend Nahrung haben, erscheint unsicher. Doch im Rahmen neuer technischer Möglichkeiten wird es vorstellbar. Es ist an der Zeit, die globale Landwirtschaft neu zu denken und mit fokussierter Forschung, Investitionen und politischer Fantasie die Weichen für die Zukunft zu stellen. Der Blick reicht von der Lebenswelt afrikanischer Kleinbauern über den europäischen Konsumenten, in die Labore und Universitäten bis hin zum globalen Dünger-Kreislauf.
Freiheit
Wie kommt es, dass die Freiheit im Selbstverständnis der meisten europäischen Nationen eine so große Rolle spielt? Welche Traditionen haben dieses Phänomen unterstützt und welche haben es behindert? Dieses Problemfeld, das von großer Aktualität ist, wird in diesem Band von renommierten Theologen und Philosophen dargestellt. Die Freiheit des Einzelnen und das liberale, tolerante Zusammenleben im Respekt vor der Freiheit anderer musste erst philosophisch begründet werden, bevor es politische Realität werden konnte. Die Grundlagen dieses Prozesses und der damit verbundenen Probleme zu verstehen, ist zentral für jeden zeitgeschichtlich interessierten Menschen. Zum ersten Mal wird die Entwicklung der europäischen Freiheitsidee hier im Zusammenhang gewürdigt.
Ökumenische Kirchengeschichte
In dieser neuen Ausgabe des Standardwerks, dessen erste Fassung 1970 erschien, wird die gesamte Kirchengeschichte von Autoren der beiden großen christlichen Konfessionen gemeinschaftlich dargestellt. Die Neuausgabe des bewährten Lehr- und Lesebuchs ist aktualisiert und größtenteils neu geschrieben worden. Der zweite Band führt ein in die wichtige Zeit zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit. Von der Hochscholastik über das konfessionelle Zeitalter bis zur Schwelle der Moderne reicht die Darstellung, die Ereignis- und Ideengeschichte verbindet. Die Autoren stellen dar, wie sich Glauben und Religion in dieser Zeit entwickelten und nennen die wichtigsten Namen und Ideen, die das neuzeitliche Europa und seine Glaubensgemeinschaften prägten.
Mönche, Schreiber und Gelehrte
»Auch zu schreiben versuchte er und pflegte deswegen Wachstafel und Büchlein im Bett unter dem Kopfkissen bei sich zu führen, um in müßigen Stunden seine Hand an das Nachmachen von Buchstaben zu gewöhnen.« Diese Schilderung der Bemühung Karls des Großen um die Erweiterung der eigenen Bildung kann als der symbolische Beginn für die mittelalterliche Gelehrsamkeit gelten.
Das christliche Mittelalter definiert sich auch über Bildung: Soweit mönchische Gelehrsamkeit reichte, soweit reichte Europa, auch unter diesem Gesichtspunkt wurde es als einheitlicher Raum gesehen. Ulrich Nonn widmet sich allen Bereichen der Thematik. Er schildert die antiken Grundlagenmittelalterlicher Bildung. Er erläutert die karolingische Renaissance, die ›Artes liberales‹ oder die Scholastik. Er zeigt Bildung und Lehrbetrieb an Klosterschulen und Universitäten und macht deutlich, wie das mittelalterliche Wissen sich allmählich zum frühneuzeitlichen Humanismus wandelt. Die intellektuellen Grundlagen Europas – hier werden sie anschaulich und ansprechend ausgebreitet.
Einführung in die Intermedialität
Intermedialität hat sich in den vergangenen Jahren als Forschungsgebiet an der Schnittstelle zwischen Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft etabliert. Die Frage nach der Kombination und Konkurrenz der Medien und Künste betrifft ein weites Spektrum von Phänomenen. Es reicht von den Kontroversen um den Vorrang der Künste in Antike und Früher Neuzeit über die Kino- und Mediendebatten der Moderne bis zur klassischen Intertextualitätsforschung und Mediengeschichte. Dieser Band untersucht Geschichte, Theorie und Systematik der Intermedialität von einem literaturwissenschaftlichen Standpunkt aus. Neben einer Klärung der leitenden Begriffe bietet er einen Abriss der historischen Entwicklung sowie einen Überblick über die Forschungs- und Arbeitsfelder intermedialer Literaturwissenschaft. Einzelanalysen nehmen (Hyper-)Texte, Bilder, Filme, Lieder und das Verhältnis von Medium und ›gender‹ in den Blick.
Das Böse in den Weltreligionen
Das ›Böse‹ ist eine vielfältige Wirklichkeit: Es meint einerseits alles Schlechte, das aus der Endlichkeit und Vergänglichkeit des Menschen resultiert, alle aus der Natur entspringenden Übel (Naturkatastrophen, Krankheit …) und die moralische Schuld als die dunkle Kehrseite der menschlichen Freiheit. Die Frage nach dem Bösen ist zutiefst verbunden mit dem Geheimnis des Menschen selbst, seines Seins, Tuns und seiner Selbstdeutung. In den großen Weltreligionen spielen das Böse und seine mögliche Überwindung eine zentrale Rolle. Der vorliegende Band ist eine gründliche und umfassende Untersuchung über das Böse in den religiösen Traditionen Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Die Beiträge bestimmen in einem ersten methodischen Teil das Wortfeld für Böses, Übles, Schlechtes und Leid in den jeweiligen Kultursprachen. Danach werden die zentralen Texte der jeweiligen religiösen Tradition vorgestellt und analysiert, und schließlich legen die Autoren systematisch dar, was Böses, Leid und Schuld in den einzelnen Religionen bedeuten und wie diese Realität bewältigt wird.