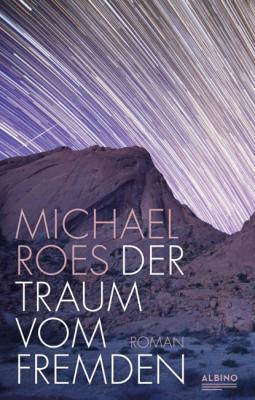Der Traum vom Fremden. Michael Roes
Читать онлайн.| Название | Der Traum vom Fremden |
|---|---|
| Автор произведения | Michael Roes |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783863003272 |
Und endlich klappt die Päpstin das Schuld- und Sündenbuch zu, unzufrieden mit dem verstockten Sohn, unter dessen pockennarbiger Stirn Ekel und Auflehnung rumoren; sie weiß es, sie sieht es: hat er nicht ihre kalten blauen Augen?
Hier träumt er von Schwärze, Sonnenglut, träumt von schwarzer Liebe und Savannenflaum.
Ist es der Tod ihres Vaters oder der Abschied vom Hauptmann, der die Päpstin fortan nur noch Schwarz tragen läßt, als sei sie bereits Witwe? Das Grab ihres Vaters ist kaum zugeschüttet, da zerrt sie mich allein auf den Friedhof, auch ich ganz in Schwarz gekleidet. Sie hat nicht nur ein Grab für den Großvater gekauft, sondern (vielleicht weil es billiger war) eine ganze Familiengruft. Immerhin schien ihr diese Ausgabe so verschwenderisch, daß sie unsere schöne Wohnung in der Grand Rue aufgab und uns alle in eine nur halb so große Unterkunft ins Arbeiterquartier von C. umzuziehen zwingt. Das hätte für mich und meine Geschwister auch ein Glück sein können: hätten wir nur mit den armen Nachbarskindern spielen dürfen!
Sie bittet den Totengräber, neben Großvaters Ruheplatz ein weiteres Grab auszuheben: Hilf mir hinein! fordert sie mich auf. Ich fürchte mich, hier auf dem Friedhof, nicht vor den Toten, ich fürchte mich allein vor ihr, der Päpstin. Du wirst dich schmutzig machen, sage ich zaghaft.
Mag sein, mein Sohn, aber es wird die Seele reinigen.
Es gibt zwei kleine Mäuerchen aus Backsteinen, auf die ihr Sarg gestellt werden soll. Sie schickt mich nach dem Totengräber und zeigt ihm genau, wo sie liegen möchte. Bevor man den Stein, der Tür genannt wird, am Eingang zumauert – er ist gerade fünfzig Zentimeter lang, so daß man den Sarg eben hineinschieben kann –, will sie alles noch einmal ganz genau betrachten. Der stumme Totengräber läßt sie ganz vorsichtig bis ans Ende der Grabkammer kriechen.
Nun komm auch hinab, Junge! höre ich dumpf ihre Stimme aus der Grube: leg dich zu mir! Hier werden wir dereinst alle ruhen, ich zwischen meinem Vater und meinen Söhnen.
MONTAG, DEN 8. OKTOBER 1883
Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir zunächst geblendet, weil wir zuviel sehen. Wir müssen lernen, die Augen zu schließen und weniger zu sehen, um überhaupt etwas zu sehen. Ja, sehen lernen heißt im Grunde: immer mehr aus unserem Sichtfeld auszublenden und nicht zu sehen. Unterstellen wir nicht deshalb den Blinden, mehr zu sehen als alle Sehenden zusammen?
Vielleicht gilt das auch für das Sprechen: um sprechen zu lernen, muß man alle anderen Sprachen vergessen, die ein Neugeborenes noch zu sprechen in der Lage ist.
Nach dem Erwachen (ist das gestrige Gespräch mit Brémond schuld?) plötzlich das zweifelhafte Verlangen, mit einer Frau zusammenzusein, nicht der Erfüllung eines geheimen Begehrens, sondern einfach ihrer Gesellschaft wegen. Das Leben in Harar (und um wieviel mehr auf dieser Reise) entbehrt nun doch zu sehr aller Weiblichkeit. Vor allem spüre ich den Trübsinn und das enttäuschte Verlangen der anderen.
Ich selbst versuche hier womöglich das Hauptübel meiner Kindheit zu heilen: Nie hat die Päpstin mich mit Knaben meines Alters verkehren lassen; fast wäre ich zu einem großen Duckmäuser geworden, denn selbst in den Schulpausen blieb ich allein oder in Gesellschaft meiner Schwestern. Indes las ich bereits den Don Quichotte, während meine Kameraden noch Mühe mit dem Entziffern der ABC-Fibel hatten. Wenn es etwas zu lachen gab, so habe ich es für mich behalten. Die Päpstin hätte mir den Cervantes – zu Recht einigen gottlosen Unrat witternd – sofort aus den Händen gerissen. Im Grunde habe ich, seit der Hauptmann uns verließ, nicht mehr gelacht.
Nie haben wir ein Nachbarskind zu uns nach Hause eingeladen; nie durfte ich einen Klassenkameraden zu Hause besuchen. Verständlicherweise blieben die Einladungen bald gänzlich aus. Hier im Ogaden kann der Reisende nicht überleben, wenn ihn die Bewohner nicht gelegentlich an ihren Herd laden. Von den ersten Fußmärschen an war mein Reisen wohl immer auch eine Suche nach Gastfreundschaft.
Die tote Schwester steigt die Treppe hinab, dann geht sie den Bahnsteig entlang, die Bremsen der Lokomotive kreischen, hat man sie nicht aufrecht in der Friedhofsmauer beigesetzt? Der Hauptmann ist im Süden geblieben und zur Totenfeier nicht gekommen. Seitdem er fortgegangen ist, hat die Uhr im Speisezimmer nicht mehr geschlagen. Er hat den Schlüssel mitgenommen. Immer ist es jener, den man liebt, der einen am Ende davonjagt.
Ich habe keinen von ihnen geliebt; weiß nicht, warum ich mir die schönen Mädchenlocken, die alle so verachtet haben, abrasiere; stehe fröstelnd am Straßenrand, wollte, ein Fuhrwerk hielte an und der fremde Mann hieße mich einsteigen. Der Weg ist lang, die Luft im Innern der Kalesche steht, der Fremde mustert mich, wie man eine Dirne mustert, ich grinse wie ein Idiot: wann öffnet er endlich den Gürtel, wann zückt er das blitzende Messer? Die Reise ist endlos. Monströse Nacht.
Von einem Pfad kann keine Rede mehr sein; es ist: als kletterten wir auf allen vieren zum Paß hinauf. Jeder Kameltreiber hält sich dicht bei seinem Tier und beruhigt und ermutigt es mit einem jeweils eigentümlichen Gesang. Und die Tiere lauschen und lassen sich von der Melodie und dem Rhythmus seiner sanftmütigen Sirene lenken. Sie scheinen die im Gesang verborgenen Befehle genau zu verstehen und setzen, selbst wenn sie mit eigenen Augen den Steig nicht sehen können, ihren Fuß dorthin, wo ihr Treiber einen sicheren Halt vermutet. Mögen diese wundersamen Tiere auch für das Durchqueren heißer sandiger Ebenen hervorragend gerüstet sein: für das Erklettern von steilen steinigen Pfaden mit nachgebendem Geröll sind sie nicht geschaffen. Und wir – weder dem einen noch dem anderen angepaßt – was haben wir in dieser rauhen Gebirgswelt zu suchen? Verletzlich sind wir und allein im Schweigen der Berge.
Wir reiten durch unbewohnte Erde, eine Totenlandschaft, aber die Toten schlafen noch. Sie zeigen sich erst, wenn die Sonne im Mittag steht.
Hin und wieder stoßen wir auf die verlassenen Hütten der Hirten, vom Licht ausgelaugt, das umliegende Gras verdorrt, das Gebüsch laublos. Also sind sie mit ihrem Vieh weitergezogen. Manchmal wohnen sie mit ihren Schafen und Ziegen zusammen auch in Höhlen: außer dem Licht muß man sich in dieser Jahreszeit auch vor dem Regen schützen. Der Wind weht unregelmäßig, aber gelegentlich heftig, ein eigensinniger, mal kalter, dann wieder heißer und staubiger Wind aus dem Innern des Kontinents. Mit seinen haarfeinen Geißeln peitscht er die Menschen wie die Tiere.
Pater Etienne, des jungen Mauricens Confrater, ist ein weitaus älterer, ungemein zarter und zerbrechlicher Landsmann aus Lyon. Seine Kutte hängt wie ein Sack um seine ausgezehrte Gestalt. Er hat ein stilles und gleichermaßen asketisches Gesicht. Unter der trotz der sengenden Sonne fahlen, pergamentnen Haut zeichnen sich die dunklen Linien der Adern, Sehnen und Knochen ab wie eine verwitterte Keilschrift. Ich kann nicht behaupten, ich hätte es vorhergesehen; aber es wundert mich nicht: als Pater Etienne während des unsicheren, suchenden Gangs seines Maultiers auf dem unebenen Pfad plötzlich aus dem Sattel kippt und unabgestützt auf den steinigen Boden stürzt. Von Anbeginn wirkte er wie einer, der bereits vom Tod in die Arme geschlossen ward und die letzte Ölung erhalten hatte, dann aber noch einmal, womöglich gegen seinen Willen, ins Leben zurückgeschickt wurde: Hier ficht er nun einen andauernden nervösen Kampf gegen seine Hinfälligkeit aus, der seinem verhärmten Antlitz eine angespannte Schönheit verleiht.
Es ist ein heißer Tag: Ich benetze das Gesicht des Gestürzten mit Wasser aus meinem Ledersack und untersuche den Schädel, dann die weiteren Knochen, ob irgendeiner gebrochen. Pater Maurice steht betend neben uns. Seitdem wir unterwegs sind, und vermutlich schon Tage davor, hat der alte Kapuzinermönch kaum Nahrung zu sich genommen und sich vom Morgen bis zum Abend gerade einmal mit ausreichend Wasser begnügt, um noch nicht verdurstet zu sein. Nur nach mohammedanischem Kalender, doch durchaus nicht nach christlichem, befinden wir uns gerade in der Fastenzeit: und als ich Pater Maurice auf dieses unnötige, ja gefährliche Exerzitium seines gebrechlichen Confraters anspreche, gibt er bloß Auskunft: es handle sich um ein ganz persönliches Gelübde, eine unverbrüchliche Abmachung zwischen Etienne und Gott. Was für eine unverzeihliche Tat kann der Grund sein, hier in der Einöde unter Lebensgefahr dafür Buße zu tun?
Ich fordere Pater Etienne auf: seine Glieder zu bewegen, eines nach dem anderen. Noch sind seine Bewegungen hilflos wie die eines Gefangenen, den man vom Streckbett befreit. Gebt mir einen Augenblick Zeit: flüstert er. Auch zuvor klang in seiner Stimme –