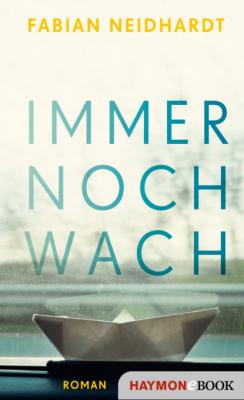Immer noch wach. Fabian Neidhardt
Читать онлайн.| Название | Immer noch wach |
|---|---|
| Автор произведения | Fabian Neidhardt |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783709939376 |
~
Der Wagen wendet und verlässt die Zufahrt. Es ist früher Abend und ich habe den ganzen Tag gesessen. Ich strecke mich in den Wind und bemerke kaum, wie Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand instinktiv die Stelle unter den Rippen suchen und ich einatme.
Es war lange Zeit nicht klar, ob zum richtigen Zeitpunkt überhaupt ein Zimmer frei ist. Viele Menschen sterben, die Warteliste ist lang. Jetzt stehe ich hier und sehe niemanden. Aus ein paar Fenstern scheint Licht, hinter einigen Gardinen flimmert das Fernsehblau. Aber niemand ist auf dem Hof, niemand steht auf den kleinen Balkonen oder sieht aus dem Fenster.
Etwas streicht an meinen Beinen entlang und ich zucke zurück. Die Katze wirft mir einen lauernden Blick zu und läuft um die Ecke des Hauses. An der Wand hängt ein Schild, in pastellfarbenem Braun und Türkis, eine Silhouette der Gebäude, die mich umgeben, darunter der Name.
Haus Leerwaldt. Den letzten Tagen Leben geben.
Zwischen meinen Schulterblättern kribbelt es. Ich räuspere mich, nehme den Rucksack und ziehe den Koffer über den Schotter zur Eingangstür.
~
Der Mann hinter der Theke ist Anfang 20 und sieht mich so freundlich und vertraut an, dass ich mir sicher bin, dass er mich mit jemandem verwechselt. Er steht auf und ich lege meine Hände auf die Holzfläche des Tresens. Später werde ich wissen, dass Martin zu jedem so freundlich ist.
„Herzlich willkommen in Haus Leerwaldt. Was kann ich für Sie tun?“
„Alexander Fink. Ich möchte … einchecken? Sagt man das so?“
Er lächelt und beugt sich zu der Tastatur.
„Die meisten sagen gar nichts. Aber die meisten kommen hier auch nicht alleine reingelaufen. Hallo Herr Fink, ich bin Martin. Nehmen Sie gerne Platz, ich sage Frau Renninger Bescheid, dass Sie da sind.“
Indirektes, warmes Licht beleuchtet den Raum, ein heller, türkisfarbener Streifen verläuft in einem Meter Höhe über die Wände. Die Lehnen des Sofas und der Sessel sind aus dunklem Holz, daneben steht eine Pflanze, die aussieht wie eine Palme.
Auf dem kleinen Tisch vor einem Sofa steht eine Schale mit Süßigkeiten, daneben liegen ein paar Zeitschriften. Der Spiegel, die Glamour, die AutoMotorSport, die Landlust.
Die Tür neben dem Empfang öffnet sich und Martin tritt mit Frau Renninger heraus. Sie ist älter als auf dem Foto im Internet, die Haare sind kürzer und grauer und das Gesicht hat eine rundere Form, die Brille ist neu. Sie ist nur ein wenig kleiner als ich und hat einen überraschend kräftigen Händedruck.
„Haben Sie gut hergefunden? Kommen Sie. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gepäck? Ich gehe davon aus, dass Sie müde sind. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer und lasse Ihnen das Abendessen bringen. Sie können in Ruhe ankommen und wir unterhalten uns morgen. Dann zeige ich Ihnen auch den Rest unseres Hauses.“
Der Gang ist mit dem gleichen warmen Licht beleuchtet, der Holzboden schimmert und knapp über dem türkisfarbenen Streifen verläuft ein Handlauf an den Wänden. Rechts sind die Fenster zum Hof, auf der linken Seite des Flurs gehen Zimmer ab, jedes mit eigener Klingel samt Messingschild, eingravierter Nummer und einem Feld, auf das eine geübte Hand Namen gemalt hat. Über jeder Tür ist eine unauffällige, zweifarbige Ampel angebracht. Manche Türen sind nur angelehnt und eine so weit geöffnet, dass ich den laufenden Fernseher und ein kleines Nachtlicht in Mondform sehen kann.
Wir kommen an einer Nische vorbei, in der weitere Sessel stehen und von der eine Glastür nach draußen führt. Der Gang steigt sanft an und ich verstehe, dass wir von einem Haus ins nächste gehen. Kurz darauf bleibt Frau Renninger an einem Aufzug stehen.
„Wir befinden uns nun im Matthiasflügel. Ihr Zimmer liegt im zweiten Stock. Wir haben zwar seit vorgestern noch ein Zimmer im Erdgeschoss frei, aber Sie gehören zu den agileren Gästen. Da können Sie noch ein paar Stockwerke überwinden. Sobald sich das ändert, bekommen Sie einen Rollstuhl.“
„Okay.“
Die Fahrstuhltüren öffnen sich und ich folge Frau Renninger durch einen weiteren Flur.
„Wie gesagt, morgen werden Sie durch das Haus geführt, und dann finden Sie sich auch bald zurecht.“
„Okay.“
Vor einer Tür steht eine kleine rote Kerze auf dem Boden, deren Flamme sich sanft bewegt. Wir gehen daran vorbei und ich drehe mich nach ihr um.
„Die Kerze?“
„Der Gast ist heute Nacht verstorben. Im Gemeinschaftsraum brennt eine weitere. So weiß jeder Bescheid.“
„Okay.“
Wir biegen um eine Ecke und bleiben vor einer offenen Tür stehen, Zimmer 208. Frau Renninger zeigt in den offenen Raum.
„Bitte sehr. Ihr Zimmer.“
Durch die beiden Fenster sehe ich die ersten Bäume des Waldes, eine Glastür führt auf einen kleinen Balkon. Das Bett steht unter der Dachschräge, gegenüber ein Tisch und zwei Stühle, darüber ein Fernseher an der Wand. Direkt neben der Zimmertür eine Schiebetür aus Milchglas, die ins Bad führt. Auf der anderen Seite ein in die Wand eingelassener Schrank.
„Falls Sie Fragen haben, neben dem Bett steht das Telefon. Im Notfall können Sie auch den Knopf drücken.“
„Okay.“
„Kommen Sie gut an. Haben Sie eine gute Nacht.“
Sie streckt mir ihre Hand hin und geht. Ich ziehe den Koffer in das Zimmer. Mein Zimmer. Mein letztes Zimmer.
4
Ich habe keine Erinnerung an ein Leben ohne Bene. Wir kennen uns, seit wir mit zwei Jahren das erste Mal zusammen in einem Sandkasten gespielt haben. Wir haben uns gegenseitig Schaufel und Formen ausgeliehen, ich habe einen Sandkuchen gebacken und Bene ein Eis gemacht, die Waffel aus Plastik, der Rest aus Sand. Bene hat alles probiert. Danach haben unsere Mütter die Spielsachen nach den aufgemalten Nachnamen geordnet und sich lächelnd verabschiedet. Bene und ich jedoch haben uns seither nicht mehr aus den Augen gelassen. Er ist ein Teil meines Lebens. Linke Hälfte meiner Seele.
Wir waren zusammen im Kindergarten und in der Schule, ich habe bei ihm übernachtet, als mein Vater gestorben ist, und wir haben uns gemeinsam fürs Studium beworben. Wir haben zusammengewohnt, er stand bei der Beerdigung meiner Mutter neben mir, durch ihn habe ich Lisa kennengelernt und wir haben uns gemeinsam über unsere Jobs aufgeregt. Über monotone Arbeitszeiten, über nervige Chefs und über dieses beschissene Gefühl, Lebenszeit für etwas zu verschwenden, das einem überhaupt nicht am Herzen liegt.
5
Die wenigen Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, als er noch gesund war, ähneln sich alle. Er sitzt am Tisch in der Küche und isst, was meine Mutter gekocht hat. Ich sitze neben ihm, meine Mutter mir gegenüber. Ich bin als Erster fertig, ich schlinge, denn dann kann ich meinem Vater erzählen, was ich an diesem Tag gemacht habe.
Er isst bedächtig und betrachtet dabei die Tischplatte zwischen uns. Manchmal fallen ihm die Augen für einen Moment zu, manchmal sinkt sein Kopf ein wenig in Richtung Brust, dann zuckt er, sieht mich an und lächelt sein halbes Lächeln, zu müde für ein ganzes.
Ich mache immer wieder Pausen in meinen Berichten und warte auf sein Nicken. Manchmal isst er stoisch weiter, den Blick immer auf das gleiche Stück Tischplatte gerichtet. Dann rutsche ich auf meinem Stuhl ein wenig nach vorne und lege meinen Kopf so auf den Tisch, dass er mich ansehen muss. Er grinst dann und fährt mir durch die Haare. Obwohl er sich die Hände jeden Abend schrubbt, bevor er sich an den Tisch setzt, sind die Ränder seiner Fingernägel immer ein wenig verfärbt. Weil das Motoröl sich