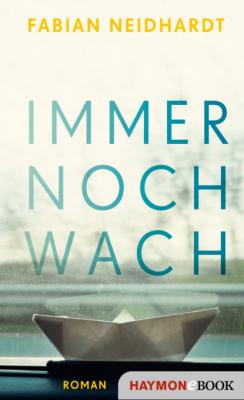Immer noch wach. Fabian Neidhardt
Читать онлайн.| Название | Immer noch wach |
|---|---|
| Автор произведения | Fabian Neidhardt |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783709939376 |
Manchmal müssen wir mit dem Essen auf ihn warten. Meistens essen wir dann trotzdem allein, aber wir fangen nicht sofort an. Wenn mein Vater so spät kommt, dann flucht er über alles. Ich denke, wenn er so viel länger arbeiten muss, dann müsste er doch eigentlich noch müder sein. Stattdessen erzählt er, von seinem Chef und den Kunden und den Ersatzteillieferanten und wie scheiße einfach alles ist. Ich sehe ihn mit großen Augen an und nach einem Schwall von Schimpfwörtern, die meine Mutter nicht mal mehr kommentiert, schaut er zu mir.
„Alex, du darfst später arbeiten, was du willst. Aber geh auf die Uni. Lern was Richtiges. Mach es nicht so wie ich.“
~
Das ist der einzige Ratschlag, von dem ich sicher weiß, dass ich ihn von meinem Vater bekommen habe. Bis ich studieren kann, ist er schon lange tot. Aber natürlich studieren Bene und ich. Die Leute sagen, mit BWL stünde uns die Welt offen. Die Welt, das sind in diesem Fall Büros, in denen wir unsere jahrelang erlernten Fähigkeiten nutzen, um Zahlen aus der einen Tabelle in eine andere zu übertragen. Aber wir wohnen in unserer eigenen Wohnung und ich habe mein eigenes Zimmer.
6
Eine fremde Umgebung, ein fremdes Bett, die Geräusche der Nacht sind vollkommen andere und wahrscheinlich habe ich mich doch noch bei Lisa angesteckt. Trotz der Decke wird mir immer kälter, bis ich irgendwann stöhnend mit den Zähnen klappere und mein ganzer Körper zittert.
Ich zerre einen Pullover aus meinem Koffer und wickele mich in ein großes Handtuch, ziehe zwei Paar Socken übereinander und drehe die Heizung auf, dann krieche ich wieder unter die Decke.
Mehr Wahn als Traum, ausgefranste Bilder von Lisa und mir, von Bene, Sandra, Lea, meinem Vater, der darum weint, dass jetzt ich den Krebs bekommen habe und wie gern er ihn wieder zurücknehmen will, und der schwarze Klumpen unter den Rippen, der immer härter und größer wird, sodass sich die Haut dunkel verfärbt und ausbeult, die Rippen brechen und durch die Haut stechen, sie sehen aus wie die Grabsteine meiner Eltern.
Irgendwann wache ich verschwitzt auf, alles klebt, alles ist eng. Ich ziehe mir den Pullover über den Kopf und befreie mich aus dem Handtuch, in dem sich mein Körper verheddert hat. Und erst, als es wieder hell wird, realisiere ich, dass ich mein Lieblingskissen zwar dabei, aber noch nicht ausgepackt habe. So konnte es keine gute Nacht werden.
Helen ist eine der Schwestern, sie hat mir am Abend zuvor das Essen gebracht und sich vorgestellt. Jetzt klopft sie wieder. Ich bin wach, aber meine Glieder schmerzen, mein Kopf pocht dumpf, ein konstanter Druck hinter den Augen, und mir ist so schlecht, dass ich mich kaum aufsetzen kann. Seit ihrem letzten Besuch scheint eine höllische Ewigkeit vergangen zu sein. Ich stöhne auf und lasse mich wieder zurückfallen.
„Wie war die erste … Oh, wohl nicht so gut. Bleiben Sie ruhig liegen.“
Sie stellt das Tablett auf den Tisch und kommt zum Bett, greift an eine versteckte Leiste am Kopfende und ich spüre, wie mein Oberkörper sich hebt. Als ich aufrecht sitze, stellt sie das Tablett auf den ausgeklappten Beistelltisch, den sie mir über die Beine schiebt.
„Sie sehen nicht gut aus. Aber Frau Renninger müsste sowieso nach dem Essen kommen. Dann schauen wir mal, ob das nur die erste Nacht in einer neuen Umgebung war.“
„Ich befürchte nicht. Meine Freundin war krank, als ich gefahren bin, und ich glaube, ich habe mich angesteckt.“
„Frau Renninger wird sich das ansehen. Guten Appetit.“
Sie nimmt das Geschirr vom Abendessen, schließt die Tür hinter sich und ich muss niesen.
~
Es klopft, ich schrecke aus meinem Dämmern und Frau Renninger steht im Zimmer, in ihren Händen verteilt sie das Desinfektionsmittel.
„Wie fühlen Sie sich?“
Ich wische mir die Spucke aus dem Mundwinkel und verziehe das Gesicht, als ich den Kopf hebe. Meine Nackenmuskeln schmerzen, mein Kopf ist heiß und mein Magen flau. Mein Körper führt einen Krieg gegen sich selbst.
„Nicht gut.“
Sie betrachtet mich, sieht zum kaum angerührten Frühstück und nickt nach einem kurzen Moment.
„Ich schicke gleich jemanden vorbei. Und ich schlage vor, wir verschieben den Rundgang, bis Sie wieder fit sind. Alles andere genauso. Kommen Sie erstmal an und erholen Sie sich. Einzig die Bescheinigung bräuchte ich. Nein, bleiben Sie liegen, sagen Sie mir einfach, wo sie ist.“
Sie findet die Mappe, stellt das Tablett auf den Tisch und zeigt mir, wie das Bett funktioniert. Ich drehe mich auf die Seite, höre, wie die Tür zugeht, und schließe erschöpft meine Augen.
~
Als ob mein Körper nur darauf gewartet hat, hier anzukommen, holt er nach, was ich die letzten Wochen wohl unterdrückt habe. Fieber, Husten, Schnupfen und schmerzende Glieder, Kopfschmerzen sowieso, und immer wieder übergebe ich mich in die Tüten, die Martin mir gebracht hat. Weißes, undurchsichtiges Plastik mit einem festen Ring an der Öffnung, sodass man sie direkt verwenden kann. Und immer, wenn ich die Augen schließe, das Bild von Lisa und Bene und den andern am Bahnhof, das nicht schwächer wird. Ich dachte eigentlich, das Schlafshirt von Lisa würde mich beruhigen. Es macht genau das Gegenteil. Seit ein paar Tagen liegt es ganz hinten im Schrank.
Martin und Helen und die anderen Mitarbeiterinnen kommen mehrmals am Tag, bringen die Mahlzeiten und unterhalten sich mit mir. Aber ich will nicht sprechen. Ich bin erschöpft, ich schmerze, ich will, dass alles vorbei ist. Bin ich nicht deshalb hier?
Ich schleppe mich ins Bad und sitze mit hängendem Kopf auf der Schüssel oder verbringe in die Decke eingepackt ein paar Minuten auf dem Balkon. Das Zimmer stinkt nach Erbrochenem, der Geruch setzt sich fest.
Ich hab es schon immer gehasst, mich übergeben zu müssen. Ich hasse es, wenn sich der Magen und all die Muskeln um ihn herum zusammenziehen, wie etwas meine Speiseröhre in falscher Richtung durchquert und mein Rachen und mein Mund sich anspannen. Hasse den Geschmack, den ich auch durch mehrmaliges Ausspülen nicht aus dem Mund bekomme. Hasse das Brennen in der Speiseröhre und die eklige Erschöpfung, wenn die Muskeln sich beruhigen. Allein der Gedanke daran verpasst mir eine Gänsehaut. Und der Geruch erst. Jeder Atemzug ein Aufglimmen der Erinnerung, die ich nie verdrängen konnte.
7
Als mein Vater zum ersten Mal mehrere Wochen im Krankenhaus liegt, bin ich fast immer bei ihm. Ich gehe nicht mehr in die Schule, weil was bringt die Schule, wenn der Vater nicht mehr da ist? Nur wenn eine Schwester ihm hilft, aufs Klo zu gehen, ohne das Bett zu verlassen, schleiche ich beschämt aus dem Raum.
Immer wieder darf ich sogar bei ihm übernachten. Manchmal auf dem Stuhl, meist neben ihm im Bett, mein Gesicht an seiner Brust, sein Arm um meinen Körper. Das Bett ist viel zu schmal und ich passe auf, dass ich nicht herausfalle, immer höchstens im Halbschlaf. Die Nächte sind voller blinkender Lichter und dem sterilen Geruch von Desinfektionsmittel, oft sind Schritte auf dem Gang zu hören. Im Zimmer stehen weitere fünf Betten. Jemand hustet, jemand stöhnt auf oder kratzt sich schmerzhaft lange. Und für eine Nacht ist dieser eine Mann da.
Hager, das Haar bis auf wenige Millimeter geschoren, die Wangen extrem eingefallen und voller roter Flecken. Keine rosige, lebendige Farbe, mehr der Anblick von offenen Wunden, an denen helle Hautschuppen hängen. Auf seinem Schoß liegt eine Nierenschale aus Edelstahl, die er mit beiden Händen umfasst. Ich sitze auf dem Stuhl und beobachte, wie er auf den Platz zwischen meinem Vater und dem Fenster geschoben wird. Er sieht erschöpft aus, er atmet tief und kontrolliert und starrt in die silberne Schale. Dann hebt er den Kopf und sieht zu mir. Mein Vater schläft oder döst mit geschlossenen Augen. Seine Hand umschließt meine, immer noch rau, aber mittlerweile ist kein Dreck mehr in den Rillen, so lange ist er schon im Krankenhaus.
Der Mann lächelt