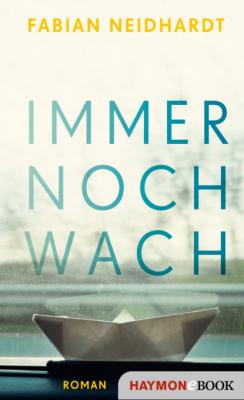Immer noch wach. Fabian Neidhardt
Читать онлайн.| Название | Immer noch wach |
|---|---|
| Автор произведения | Fabian Neidhardt |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783709939376 |
~
In der Nacht übergibt er sich immer wieder. Er isst nichts, und bald füllt er die Schalen nur noch mit Galle und Spucke. Ich verbringe die Nacht neben meinem Vater, ich habe ihm das versprochen, bevor der Mann reinkam. Liege an seiner Seite, sein Körper zwischen mir und dem Mann, aber wenn ich die Geräusche höre, die den nächsten Schub ankündigen, hebe ich vorsichtig den Kopf, so weit, dass wenigstens ein Auge ihn sieht, und beobachte, wie er mit seinem Körper kämpft, wie er sich immer wieder verkrampft, den Mund offen und voller Spuckefäden, die Muskeln am Hals angespannt, wie er immer erschöpfter zurücksinkt und tief durchatmet. Die Hände zittern, wenn er eine Schale auf dem Beistelltisch abstellt und sich eine neue nimmt. Manchmal schwappt schaumige Galle auf den Tisch. Alle paar Stunden kommt eine Schwester, nimmt die benutzten Schalen mit, putzt und lüftet.
Der Mann wird nach dieser einen Nacht wieder aus dem Zimmer geschoben, aber ich habe den Geruch noch Wochen später in der Nase.
Bald darauf geht es meinem Vater schlechter und er beginnt selbst, sich zu übergeben.
8
Die ersten beiden Wochen bleibe ich in meinem Zimmer. Martin und Helen duze ich mittlerweile, was selten ist, weil die Menschen, die hier arbeiten, sich durch das Sie eine gesunde Distanz bewahren. Intimität und Nähe gibt es hier genug. Es gibt noch fünf oder sechs andere, hauptsächlich Frauen, die regelmäßig vorbeisehen. Freundliche, meist gemütliche Menschen, die mir das Gefühl geben, willkommen zu sein. Deren Freundlichkeit und Anteilnahme echt scheint. Sie haben ein sanftes Klopfen und stecken immer erst den Kopf rein, entscheiden jedes Mal neu, ob sie im Rahmen stehenbleiben oder bis ans Bett treten. Sie wissen die Dinge, die ich ihnen erzähle, auch beim nächsten Mal noch. Ihre Namen habe ich sofort vergessen. Und zu fragen traue ich mich nicht.
~
Irgendwann ist der Infekt vorbei. Ich bin zwar immer noch schwach, habe ein paar Kilo verloren und der Druck unter den Rippen ist mittlerweile permanent spürbar, genauso wie das Stechen hinter den Augen, aber ansonsten bin ich einigermaßen fit. Trotzdem will ich nicht raus.
Mein Essen wird mir gebracht, der Fernseher lenkt mich ab, und für frische Luft stelle ich mich kurz auf den Balkon. Mehr brauche ich nicht.
Mein Zimmer ist fünf durchschnittliche Schritte breit und sieben Schritte lang. Die Decke ist abgehängt, sie klingt hohl, wenn ich auf dem Bett stehe und dagegen klopfe. In der Ecke hinter dem Bett ist ein dichtes Spinnennetz, von dem ich niemandem erzähle. Manchmal sehe ich der Spinne zu, wie sie gefangene Fliegen umgarnt. Ich nenne sie Lukas.
Alle paar Tage kommt Frau Renninger vorbei. Wie es mir gehe, ob ich etwas brauche, ob sie mir den Rest des Hauses zeigen solle. Gut, danke. Alles in Ordnung. Mein Zimmer reicht mir. Dann nickt sie.
„Sagen Sie einfach Bescheid. Es lohnt sich, glauben Sie mir.“
~
Manchmal sehe ich Helen oder Martin oder einer der anderen Mitarbeiterinnen von meinem Balkon aus zu, wie sie einen Rollstuhl nach draußen schieben oder neben jemandem gehen, der sich mit einem Rollator oder einem Stock vorwärtsquält. Manche sitzen auf den Bänken und lesen, immer wieder raucht jemand, die Fitteren machen einen Spaziergang in den Wald. Durch den gepflasterten Weg ist das auch für die Gäste im Rollstuhl möglich. Trotz September sind die meisten Leute schon warm eingepackt und unter den Mützen ahne ich oft haarlose Köpfe.
Manchmal schreit jemand in der Nacht, dann eilen Schritte über den Flur. Und natürlich weint immer wieder jemand. Es ist schön hier, wir sind alle Gäste und Liebe und Frieden und so. Aber fast jeder Mensch, den ich hier treffen könnte, wird demnächst sterben.
Mein eigener Tod ist mir erstmal genug.
9
Wir sind sowieso jeden Tag im Café, aber nach der Eröffnung sind wir fast rund um die Uhr dort. Wir arbeiten mehr als jemals zuvor und ich merke, wie ich an meine Grenzen komme. Ich bin immer erschöpft und müde, habe regelmäßig Kopfschmerzen und manchmal ist mir so übel, dass ich denke, mich übergeben zu müssen. Und trotzdem bin ich glücklich.
Jeden Tag gibt es diesen einen Moment, in dem ich irgendwo lehne und die Leute beobachte. Unsere Gäste. Und das wiegt alles auf. Ich tue, was ich immer tun wollte. Warum soll ich mich beschweren?
~
Es ist Dienstagnachmittag, ich stehe im Verkaufsbereich hinter der Theke und lasse die Rechnung für Tisch sieben raus, einer der runden Tische vor den Fenstern. Lisa kommt demnächst, um mich abzuholen, Bene zieht sich für seine Schicht um. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, höre ein Fiepen im linken Ohr und spüre mal wieder dieses Ziehen im Magen, das seit Wochen nicht weggeht. Oft bemerke ich es nicht, aber in ruhigeren Momenten meldet es sich. Ein Druck, ein Völlegefühl, obwohl ich nichts gegessen habe.
Ich freue mich auf Lisa, freue mich auf unsere Couch. Der Drucker summt und der Streifen Papier kommt heraus. Ich will ihn abreißen, greife daneben und spüre, wie meine Beine nachgeben. Meine Sicht verschwimmt.
~
Dann ein pochender Schmerz am Hinterkopf und das bedrängende Gefühl, von mehreren Menschen umgeben zu sein. Ich verziehe das Gesicht, sauge die Luft zwischen den Zähnen ein, und noch bevor ich die Augen öffne, greife ich mir an den Hinterkopf. Eine große Beule, aber meine Finger bleiben trocken, kein Blut. Dann höre ich meinen Namen, wie im Nachhall, als ob jemand schon länger zu mir spricht, aber meine Ohren erst jetzt wieder zu hören beginnen.
Ich liege hinter der Theke, die Beine verwinkelt und gegen die Schränke gepresst. Vor mir knien die beiden Gäste von Tisch sieben und hinter ihnen steht Lisa. Sie muss gekommen sein, ohne dass ich sie bemerkt habe. Oder ich bin länger ohnmächtig gewesen. Benes Gesicht vor meinem, kopfüber, er hält mich davon ab, mich aufzusetzen.
„Bleib liegen! Mach ganz langsam. Kannst du deinen Kopf bewegen?“
Langsam neige ich den Kopf.
„Ich habe ’ne fette Beule am Hinterkopf, ansonsten scheint alles zu funktionieren.“
„Na, dann komm.“
Bene packt mich unter den Armen, richtet meinen Oberkörper auf und lehnt mich an den Schrank. Lisa hält mir ein Glas Wasser hin.
„Alles okay? Was ist passiert?“
Ich trinke vorsichtig in kleinen Schlucken und sehe sie dabei an.
„Ich habe keine Ahnung. Ich wollte die Rechnung holen und plötzlich bin ich zusammengesackt. Knie weich, nichts mehr gesehen und dann auf dem Boden aufgewacht.“
Ich sehe zu den Gästen und versuche ein Lächeln.
„Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit, ich wollte Sie nicht warten lassen. Ihre Rechnung geht aufs Haus. Danke, dass Sie da waren.“
„Schwachsinn.“
Bene steigt über meine Beine, reißt den Zettel vom Drucker und reicht ihn weiter.
„Hören Sie nicht auf ihn, er hat sich den Kopf gestoßen. 17,50, bitte.“
Lisa nimmt mir das Glas ab.
„Kannst du aufstehen? Ich helfe dir.“
Ich halte mich an der Theke fest und ziehe mich nach oben. Lisa lässt mich los, aber ihr Körper bleibt angespannt, bereit, mich aufzufangen.