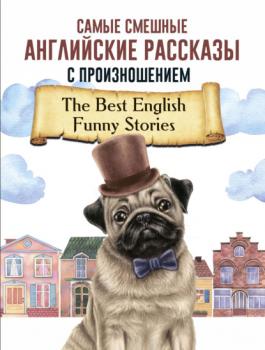Группа авторов
Список книг автора Группа авторовДачный сезон №08/2021
Секреты опытных дачников, советы лучших агрономов страны, лунно-посевной календарь. В каждом номере советы, как правильно обрабатывать почву и ухаживать за растениями, как благоустроить дачный участок с минимальными затратами, как юридически грамотно решить земельные споры и вопросы. В номере: Лучшие сорта клубники (земляники садовой) Уход за газоном в конце лета Как размножить жимолость Лечим болезни коры яблонь Сбалансированное питание убережет от переломов Как распланировать дачный участок и многое другое
Всё для женщины №31/2021
«Все для женщины» – самый популярный прикладной женский журнал, призванный облегчить и украсить жизнь своих читательниц. Дает оригинальные, но простые и актуальные советы по всем сторонам жизни современной женщины. Предлагает читательницам опыт других женщин и лучших экспертов. Журнал вдохновляет женщин, делая их жизнь насыщенной и комфортной. Более 100 идей в каждом номере.
Рисуем по клеточкам и точкам
Прописи «Рисуем по клеточкам и точкам» помогут малышу развить мелкую моторику, графические навыки, пространственное мышление и внимание. Регулярные занятия эффективно подготовят руку малыша к письму, помогут развить интеллектуальные и творческие способности. Для дошкольного возраста.
Мир животных
Серия «Цветовой квест» – необычные раскраски для всей семьи. В одном альбоме собраны несколько техник рисования и раскрашивания – по номерам, по пикселям, по точкам, пэчворк-раскраски. В основе лежат два принципа – сюжеты-загадки – изображение можно увидеть, только выполнив задание, и принцип неожиданного контраста – картины по номерам удивят вас нестандартными сочетаниями цветов. Задания даны от простого – к сложному. Готовую работу можно вырезать по линии отреза и оформить как произведение собственного творчества.
Самые смешные английские рассказы с произношением
В книгу вошли остроумные рассказы известных писателей, таких как О'Генри, Марк Твен, Джером К. Джером, Г. Х. Манро (Саки). Тексты рассказов подготовлены для начального уровня владения английским языком. Под каждым словом добавлена транскрипция, соответствующая международной фонетической системе IPA. В конце книги расположен небольшой англо-русский словарь. Издание предназначено для всех, кто изучает английский язык и стремится достичь успехов. Чтение в оригинале – это прекрасная возможность познакомиться с культурой страны изучаемого языка.