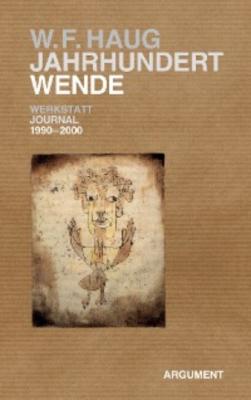Jahrhundertwende. Wolfgang Fritz Haug
Читать онлайн.| Название | Jahrhundertwende |
|---|---|
| Автор произведения | Wolfgang Fritz Haug |
| Жанр | Историческая литература |
| Серия | |
| Издательство | Историческая литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783867548625 |
Das schlechte Gewissen während des Golfkrieges nährte die Terroristenangst. Zusammenbruch des Flugtourismus und überhaupt eines Teils des Flugverkehrs. Auffallend wenig wirklicher Terrorismus in dieser Zeit.
5. März 1991, Esslingen
Der Oberste Sowjet hat ein neues Währungsgesetz verabschiedet, das schon wieder (noch immer) Staat gegen Geld (Eigenlogik des Marktes) einsetzt, derart wieder Wirklichkeit (und Eigentätigkeit der Leute) von sich abspaltend.
7. März 1991
»Von der SED gestohlenes Grundvermögen« nennt die FAZ-Leitglosse den aus Enteignungen hervorgegangenen genossenschaftlich genutzten Boden der DDR. Hybris der Sieger. Aber im Osten reift ein zweiter Aufstand heran, und die Klügeren aus den bürgerlichen Parteien haben begriffen, dass Ökonomie vor dem Prinzip Privateigentum rangiert. Zumindest verbal macht man jetzt Zugeständnisse: »Sanieren, um verkaufsreif zu machen«, soll der neue Auftrag an die »Treuhand« lauten, die bisher privatisiert hat um der Privatisierung willen und zu diesem Zweck die Unternehmen zuerst vollends ruinierte: Ausrottungskreuzzug gegen nichtkapitalistische Eigentumsformen.
*
Mit Barbara, meiner ›illegitimen‹ Halbschwester, traf ich mich auf dem Parkplatz des pforzheimer Krankenhauses Siloa. Sie führte mich auf den Trümmerberg. Als die Stadt am 22. Februar 1945 ohne jeden militärischen Sinn vernichtet wurde und mit ihr 17 000 Menschen untergingen, da war B. noch im Mutterleib. Es war wie ein Gleichnis: der Boden, auf dem wir zusammenkamen, waren die Trümmer einer großen Liebe, einer unheilbaren Verstrickung dreier Menschen. Mein Vater war beinahe vierzig, das Mädchen Else knapp halb so alt (sie ist am 4. August 1924 geboren).
Zu denken, dass diese Else, die nie einen anderen Mann hatte, noch lebte, als ich vor drei Jahren in Pforzheim über Antifaschismus sprach, während Barbara mit ihrem Mann inkognito im Publikum saß, um mich zu beobachten. Ihre Mutter lehnte damals den Gedanken, mich kennenzulernen, noch strikt ab. Jetzt versuchen wir, die fragmentarischen Hinweise, die wir von unseren Müttern haben, zusammenzusetzen und unsere jeweilige Verstrickung zu erkunden. Es ist ein Puzzle, aber kein Spiel, allzu viel Dunkles hängt an dieser Familiensaga.
Barbara hat blaugraue Augen. Sie ist Lehrerin in einer Grundschule, auf dem Trümmerberg befürchtet sie einen Moment lang, in einem Kind den Schüler wiederzuerkennen, mit dem sie am Morgen »zusammengerasselt« ist. Sie ist mit allerlei Selbstetikettierungen zur Hand, als wollte sie möglicher Kritik zuvorkommen: »unfähig zur Spontaneität«, »konfliktscheu« usw.
Ihre Mutter hat das Unglück ihrer großen und »schuldigen« Liebe auf eine Weise verallgemeinert, dass sie alles Unglück aus der Umgebung auf sich nahm; sie war »der Jesus von Pforzheim«. Als Arzthelferin die Klagen der Patienten nicht nur anhörend, sondern das geklagte Leid mitduldend. In jenem Schicksalsjahr 1945 war Elses Mutter der Schwangeren nicht beigestanden, sondern hatte sie zu einer Tante geschickt. Standardsatz der Mutter: »was sollen da die Leute sagen«. »Diesen Satz haben meine Kinder nicht ein einziges Mal von mir gehört«, sagt Barbara. Sie schildert ihre Ältere (Brita, 15) als verschlossen und hausgebunden, die jüngere (Berit, 10) als »Außenministerin« der Familie, nicht zu Hause zu halten. Als mein Brief kam, sagte Berit sofort: »kriege ich jetzt einen Onkel?«
Namenszauber: Barbara (genannt Bara), Bernd; Brita, Berit.
Als wir uns verabschieden, zögert B. einen Moment lang, ob sie mich nach Hause einladen soll. Meine Schwester zu sein, lehnt sie ab; wir haben nicht denselben Vater, sondern nur denselben Erzeuger, sagt sie, und Geschwister haben eine gemeinsame Geschichte, während wir nur eine dunkle Geschichte unter uns haben, wie den Schutt von Altpforzheim, als ein Unbewusstes unserer Kindheit.
8. März 1991
Geschichten meiner Mutter. – Die von einem Arzt eines Tags diagnostizierte Rückgratverkrümmung, die sie darauf zurückführte, dass sie als Kind stets verschraubt bei Tisch saß, weggedreht von ihrem Vater, um ihn nicht sehen zu müssen, zur Körperform gewordener Vaterhass. Irgendeine schlechte Sitte seinerseits widerte sie an. Mütterliche »Sexualaufklärung« nach ihrer ersten Periode, die viel zu früh gekommen sei, bei noch ganz kindlich dünnem Körper: »Und dann gibt es da noch etwas, aber das sollte man lieber lassen.«
In der FAZ ein Gedicht von Werner Söllner, Swanns Arrangement mit sich selbst, das, wie schon der Titel zeigt, mit Kennern von Proust kommuniziert, die den Namen Swann wie ein Emblem für die Suche eines Homosexuellen nach seiner verlorenen Jugendzeit (Jugendliebe) lesen: Vergangenheit, halb / vergessener Ton, bittere Frucht, einzig / gelebte Zeit: süßer Kern deiner Flucht. In der Gegenwart fühlt sich das poetische Ich in einem Abgrund / voll Traum und Verlust / dieser süßen Last aus allem / was du gesehen hast. Hübsch die Rede von den Zimmern / die dich noch immer bewohnen.
9. März 1991
Sabine Brandt darf im FAZ-Feuilleton hetzen, gegen Hermann Kant, Helmut Baierl, Gerhard Bengsch (»Krupp und Krause«), die sie mit Bedacht zwischen schreibenden Sicherheitspolizisten untermüllt, um darüber zu lamentieren, dass sie kraft deutscher Einheit jetzt die demokratischen Grundrechte nutzen dürfen und »unsere Mitbürger« geworden sind: »Das müssen wir schlucken, wie die Generation vor uns nach 1945 manches und manchen hat schlucken müssen.«
Laut Neil Postman hat der Durchschnittsamerikaner an seinem 20. Geburtstag 800 000 Werbespots über sich ergehen lassen. Rechnet man die ersten drei Lebensjahre ab, wären das knapp 134 pro Tag. Er würde sich nicht wundern, wenn demnächst Jesus mit einer Flasche aufträte: »Als ich damals in Kanaa Wasser in Wein verwandelte, war er nicht entfernt so gut wie dieser Pinot Noir von Gallo.«
10. März 1991
In Moskau eine riesige Demonstration der »Demokraten« gegen Gorbatschow. Afanasjew, der in meinem Gorbatschow-Buch von 1989 noch als eine der Stimmen im Einklang mit G, wenngleich sich in manchem vorwagend, vorkommt, seit mehr als einem Jahr ein scharfer Gegner, ja Feind. Als mein Buch erschien, gingen die Flitterwochen der Perestrojka, als sich noch alle Unzufriedenheit hinter G sammelte, eben zu Ende. Die Taktik Jelzins jetzt, Gorbatschows rechtsstaatliche Rekonstruktion der Sowjetunion zu durchkreuzen. Der Bürgerkrieg, vor dem G warnt, sei dessen Krieg gegen das Volk, schreien sie.
11. März 1991
Im Deutschlandsender Kultur – einem Sender der ehemaligen DDR, der noch existiert und wo ich zu Wort komme, wie nie zuvor (und vermutlich auch nicht danach) in der Bundesrepublik – eine Diskussion über Gramsci mit Johannes Agnoli und Otto Kallscheuer. Manfred Lötsch, der zugesagt hatte, bleibt aus. Meine beiden Gesprächspartner haben aus entgegengesetzten Gründen ein Interesse daran, Gramsci als Anhänger der Diktatur des Proletariats hinzustellen, Kallscheuer, um ihn zugunsten von Croce zu verlassen, Agnoli, um ihn als Kronzeugen gegen den bürgerlichen Parlamentarismus zu haben. Ich vermute dagegen, dass bei Gramsci aufgrund seiner Fragestellung (Scheitern des revolutionären Kommunismus im Westen) zu aller bewussten Fragestellung eine gleichsam hinterrücks erfolgte Problemverschiebung hinzugekommen ist, die seine weiterwirkende Aktualität ausmacht: Transposition der (Klassen-) Kämpfe in die politische Kultur. In der Gesprächsstruktur fehlt ein DDR-Intellektueller. Aus taktischen Gründen stütze ich mich vor allem auf den abwesenden Peter Glotz und spare die Kritik an ihm aus. Sie läuft darauf hinaus, dass bei ihm das emanzipatorische Projekt Gramscis wegschwimmt und eine inhaltsleere Orientierung