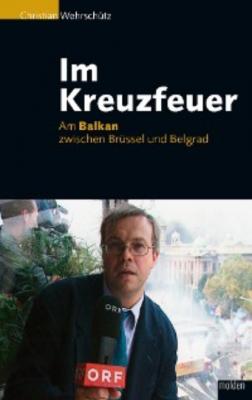Im Kreuzfeuer. Christian Wehrschütz
Читать онлайн.| Название | Im Kreuzfeuer |
|---|---|
| Автор произведения | Christian Wehrschütz |
| Жанр | Зарубежная публицистика |
| Серия | |
| Издательство | Зарубежная публицистика |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783990401545 |
4) Daten über ausländische Direktinvestitionen sowie Außenhandelsstatistiken weisen oft beachtliche Abweichungen auf. Gleiches gilt für die Zahl von Firmen, die im Ausland präsent sind, weil sich Unternehmen oft erst dann an die Außenhandelsstellen der Wirtschaftskammer oder an die Botschaften wenden, wenn es „brennt“.
5) Dasselbe gilt trotz ihrer wechselvollen Geschichte für die Hypo-Alpe-Adria-Bank und natürlich auch die oberösterreichische Asamer-Gruppe mit ihren Kies-, Zement- und Betonwerken.
6) Gerade diese führende Stellung in Slowenien und Kroatien zeigt, wie groß das Interesse Österreichs an einem raschen EU-Beitritt Kroatiens und damit an einer raschen Lösung des Grenzstreits mit Slowenien sein muss.
7) Der Westbalkan umfasst das ehemalige Jugoslawien minus Slowenien plus Albanien.
8) Zu erwähnen ist auch die enge Zusammenarbeit zwischen der Universität von Shkodra und der Universität Graz.
9) Jernej Kopitar (1780–1844) ist selbst ein gutes Beispiel für die enge Beziehung zum ehemaligen Jugoslawien. Nach dem Abschluss des Gymnasiums in Laibach und Hauslehrertätigkeiten ging der gebürtige Slowene nach Wien. Dort studierte er Rechtswissenschaften und befasste sich mit slawischen Sprachen. Seit 1810 war er an der Wiener Hofbibliothek beschäftigt, unter anderem als Zensor slawischer Bücher. Kopitar gilt als einer der Mitbegründer der wissenschaftlichen Slawistik und stand am Beginn der Bildung einer wissenschaftlichen slowenischen Grammatik. So veröffentlichte er 1808 eine „Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark“, ein Jahr später eine „Grammatik des Slovenischen“.
3.
Der Weg nach Lipovac – Kroatiens serbische Hauptstadt
Nur Bares bringt Wahres:
Mein „Lieblingsdorf“ an der kroatisch-serbischen Grenze
Der 14. Februar 2000 war ein schöner Tag und für mich gleichzeitig der Beginn einer Reise nach Belgrad und durch die „Schluchten des Balkan“, die bis heute andauert. Meinen vorläufigen Entsendevertrag als interimistischer Büroleiter in Belgrad hatte ich bereits im Herbst 1999 unterschrieben, und dann bei der jugoslawischen Botschaft in Wien um das Visum angesucht. Das bange Warten auf das grüne Licht aus Belgrad endete ausgerechnet am 23. Dezember. Die Botschaft rief an und teilte mit, dass mir das Visum erteilt werde. Für mich war diese Nachricht ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk. Auslandskorrespondent zu werden war stets mein Ziel gewesen, und nun stand diesem meinem journalistischen Traumberuf nichts mehr entgegen. Einziger wirklicher Wermutstropfen war, dass ich allein fahren musste. Die politische Lage in Serbien unter Slobodan Milošević war einfach zu unsicher, um die Familie mitnehmen zu können. Außerdem dachte niemand von uns im Traum daran, dass der Balkan zu meiner beruflichen Schicksalsregion werden und der Aufenthalt so lang dauern würde.
Auf die Herausforderungen für die Familie war ich weniger vorbereitet als auf die beruflichen Herausforderungen. Daher verliefen die privaten und beruflichen Vorbereitungen ohne große Aufregung. Als der Tag der Abreise da war, frühstückten meine Töchter Michaela, Immanuela, meine Frau Elisabeth und ich noch gemeinsam und feierten Michaelas 18. Geburtstag. Dann fuhr ich ins ORF-Zentrum am Küniglberg, holte 40.000 DM und den Transporter mit zwei Extrakanistern und fuhr gegen 11 Uhr los – Belgrad entgegen.
Das Geld brauchte ich aus demselben Grund wie die Kanister. Serbien war wegen der Politik seines Autokraten Slobodan Milošević nach langen Jahren des Zauderns und Zögerns von der UNO mit spürbaren Sanktionen belegt worden. Sie ließen sich zwar umgehen, wurden auch umgangen – das machte viele Zwischenhändler und Schmuggler enorm reich –, ruinierten aber langsam das Land und erschwerten das Alltagsleben massiv. Wegen der Sanktionen gab es in Serbien nur eine einzige westliche Bank, aber trotzdem keinen direkten, regulären internationalen Zahlungsverkehr mit dem Westen. Also brauchte ich Geld, denn in Serbien galt die Devise: „Nur Bares ist Wahres“ – und das war nicht der Dinar, sondern die Deutsche Mark, mit der ich zu rechnen lernte wie mit dem Schilling. Hätte ich all das Geld, das ich in den ersten zwei Jahren meines Mandats in meinen Hosentaschen nach Belgrad schmuggelte, vom ORF auf einmal bekommen, wer weiß, ob ich nicht schwach geworden wäre und mich abgesetzt hätte, scherzte ich oft mit meinem Drehteam.
Die Kanister brauchte ich, weil auch ein Öl-Embargo galt, und weil ich nicht sofort auf geschmuggelten und gepanschten Treibstoff angewiesen sein wollte. Wie ich sofort nach meiner Ankunft feststellen sollte, boten Händler diesen minderwertigen Treibstoff auf den Straßen in allen möglichen Ein- und Zwei-Liter-Flaschen an. Diese Tatsache verleitete meine ältere Tochter Michaela bei ihrem ersten Besuch zur verblüfften Frage: „Warum verkauft man in Serbien am Straßenrand Coca Cola in Zwei-Liter-Flaschen?“
Der erste Besuch meiner drei Damen fand erst im Mai statt, nachdem die internationale Gemeinschaft das Flugverbot nach Serbien aufgehoben hatte. Am Flughafen in Belgrad holte ich meine sichtlich nervöse Familie ab. Nach einem kurzen Aufenthalt in meiner Wohnung fuhren wir sofort auf den Kalemegdan – eine Parkanlage auf dem ehemaligen Glacis der Festung von Belgrad – und tafelten in einem Restaurant mit einem wunderbaren Ausblick über die Mündung von Donau und Save. Dabei schwand die Nervosität, die nicht zuletzt Freunde der Familie geweckt hatten. Belgrad und Serbien hatten das Image eines Kriegsgebiets, in dem überall Gefahren lauerten. An seinem schlechten Image ist Serbien leider weitgehend selbst schuld, doch die Realität entsprach auch damals nur teilweise dem Bild, das viele internationale Journalisten gezeichnet hatten. Am folgenden Tag besuchte ich dann noch mit meinen Töchtern den größten McDonald’s im Stadtzentrum. Damit konnte ich meinen Töchtern ein wenig „westliche Normalität“ vermitteln, trotz aller großen Mangel- und Verfallserscheinungen, die Belgrad und Serbien damals von der Müllabfuhr bis zur Stromversorgung gekennzeichnet haben.
Das Auto brauchte ich, weil es wegen der Sanktionen keinen Flugverkehr zwischen Wien und Belgrad gab; wie hätte ich sonst Kanister und Gepäck transportieren und das Geld nach Serbien schmuggeln sollen? Das Fahrzeug bereitete mir ein beträchtliches Unbehagen. Entgegen meiner Bitten und Ratschläge hatte mir mein fürsorgliches Unternehmen einen fast nagelneuen Mercedes-Transporter gegeben, der nur 2.000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Für alle Autodiebe, die es damals in Serbien in noch weit größerer Zahl gab als heute, war dieses Fahrzeug ein Objekt der ständigen Begierde erster Ordnung. Was ich mit diesem Auto, das ich in Serbien praktisch nie fahren würde, in den kommenden Monaten noch erleben sollte, wusste ich bei der Anreise allerdings noch nicht.
Als Reiseroute nach Belgrad wählte ich den Weg über Graz, und zwar aus zwei Gründen: Erstens wollte ich noch kurz meine Eltern besuchen, die in Graz wohnen. Zweitens waren die Straßen in Slowenien und Kroatien besser als in Ungarn, obwohl auch der Ausbau der Autobahnen in den beiden ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken