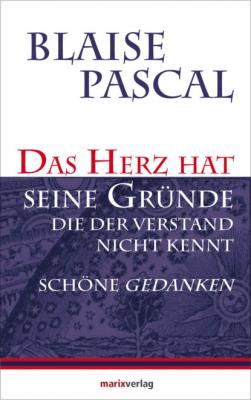Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Blaise Pascal
Читать онлайн.| Название | Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt |
|---|---|
| Автор произведения | Blaise Pascal |
| Жанр | Афоризмы и цитаты |
| Серия | |
| Издательство | Афоризмы и цитаты |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783843803175 |
Blaise Pascal wird am 19. Juni 1623 in Clermont, der Hauptstadt der Auvergne, geboren. Sein Vater, Etienne Pascal, ist selbst ein Mathematiker von Rang und steht als Steuerbeamter im Dienst der französischen Krone. Drei Jahre nach Blaise Pascals Geburt stirbt die Mutter und hinterlässt drei Kinder: neben Blaise dessen beide Schwestern Gilberte und Jacqueline. Nach dem Tod seiner Frau gibt Etienne Pascal sein Amt auf und übersiedelt mit den Kindern nach Paris, wo er sich ungeteilt deren Erziehung widmen will. Die Wahl des Wohnortes hängt vermutlich mit Etienne Pascals eigenen wissenschaftlichen Interessen zusammen: In ganz Europa bilden sich im 17. Jahrhundert die sogenannten »Akademien«, das heißt regelmäßige Zusammenkünfte, bei denen führende Gelehrte der unterschiedlichen Wissensgebiete ihre Forschungsergebnisse vorstellten und sie der Prüfung durch die anderen unterzogen. Bekannt sind vor allem die Accademia dei Lincei in Rom, der auch Galilei angehörte, die Accademia del Cimento in Florenz und natürlich die Londoner Royal Society. In Paris ist es die Zelle eines Minoritenmönches, des Paters Marin Mersenne, die zum Zentrum lebendigen Austauschs führender Gelehrter wird. Neben Etienne und später Blaise Pascal selbst treffen sich dort unter anderem Thomas Hobbes und René Descartes. Marin Mersenne selbst trat durch keine eigenen Forschungen hervor, zeichnete sich aber durch ein umfassendes enzyklopädisches Wissen aus und scheint vor allem ein außerordentliches Talent dafür gehabt zu haben, die richtigen Fragen zu formulieren. So wurde er zum Impulsgeber und Korrespondenten großer Geister des französischen »Goldenen Zeitalters« (vgl. dazu Clévenot 1989, 68–75).
Der junge Blaise Pascal hat nie eine Schule besucht. Sein Vater übernimmt persönlich den Unterricht des Heranwachsenden und orientiert sich dabei an den Vorstellungen des Humanisten und Freidenkers Michel de Montaigne. Dessen Leitprinzip bestand darin, die Lerngegenstände der psychologischen Entwicklung des Kindes anzupassen und es keinesfalls zu überfordern. So ergaben sich die Bildungsinhalte zunächst ganz selbstverständlich aus den Alltagsereignissen, zu deren Reflexion der Knabe ermuntert wurde. Bezeichnend dafür ist eine Begebenheit, die Gilberte Pascal in der Lebensbeschreibung ihres Bruders wiedergibt: Der Knabe entdeckte, dass ein Steingutteller, an den man ein Messer schlug, einen Klang erzeugte, der abbrach, sobald man den Teller mit der Hand berührte. Auf diese Weise wurde der Elfjährige zum Nachdenken über die Gesetze der Akustik angeregt (Gilberte Pascal 1991, 105).
Etienne Pascal hatte zunächst vorgesehen, dem Knaben die allgemeinen Grundlagen der Grammatik beizubringen, damit er sich daraufhin die Sprachen Latein, Altgriechisch und Italienisch aneigne. Um ihn von diesen Gegenständen nicht abzulenken, achtete er penibel darauf, ihn vor allem von der Mathematik fernzuhalten, die erst für das Alter von sechzehn Jahren vorgesehen war. Den Knaben Blaise Pascal scheint dies jedoch umso mehr zur Beschäftigung mit der Mathematik angestachelt zu haben: Gilberte Pascal berichtet: »Eines Tages kam mein Vater dorthin, wo er [Blaise] sich aufhielt, ohne dass mein Bruder ihn hörte. Er war so sehr vertieft, dass es lange dauerte, bis er das Kommen des Vaters bemerkte. Man kann nicht sagen, wer von beiden überraschter war: der Sohn, der den Vater erblickte, wegen dessen ausdrücklichem Verbot [sich mit der Mathematik zu beschäftigen], oder der Vater, der seinen Sohn inmitten all dieser Dinge [mit Kreide gezeichneter geometrischer Figuren] sah. Doch die Überraschung aufseiten des Vaters war wohl größer: Als er den Sohn fragte, was er hier mache, sagte er ihm, er suche nach der und der Sache: Es handelte sich um den 32. Lehrsatz des ersten Buches des Euklid.«2 (Gilberte Pascal 1991, 106–107) Der noch nicht Zwölfjährige hatte sich also selbstständig einen Teil der Grundlagen der Mathematik erarbeitet. Von da an nimmt der Vater Blaise Pascal zu den Zusammenkünften bei Marin Mersenne mit. Im Alter von sechzehn Jahren begründet Pascal seinen Ruf als Mathematiker mit seiner Abhandlung über die Kegelschnitte.
Die äußeren Lebensumstände änderten sich abrupt, als Etienne Pascal bei Kardinal Richelieu in Ungnade fiel. Um der Gefängnishaft zu entgehen, floh er zunächst mit seinen Kindern in die Auvergne. Der jüngeren Tochter Jacqueline – einer begabten Poetin und Schauspielerin – gelang es jedoch, den Kardinal wieder günstig zu stimmen. Etienne Pascal übernahm daraufhin die Aufgabe, in Rouen in der Normandie das Steuerwesen neu zu organisieren. Um dem Vater die beschwerliche Aufgabe zu erleichtern, konstruierte Blaise Pascal seine Rechenmaschine. Erstmals wurde die geistige Arbeit des Rechnens von einem ausgeklügelten Mechanismus übernommen – letztlich das Urbild unseres Computers.
Entscheidender aber noch für Pascals Werdegang war, dass die Familie in Rouen in Kontakt mit der religiösen Strömung des Jansenismus kam. Auslöser war ein Unfall von Etienne Pascal, bei dem er sich ein Hüftgelenk auskugelte. Die Brüder Deschamps, die ihm mit ihren chirurgischen Kenntnissen in dieser Situation beistanden, machten die Familie mit den Werken der führenden Jansenisten vertraut: Saint-Cyran, Arnaud und Jansenius selbst. Diese religiöse Strömung orientierte sich an der Gnadenlehre des Augustinus, an der absoluten Souveränität von Gottes Gnadenwahl, während ihre erbitterten Gegner, die sogenannten »Molinisten«, die Willensfreiheit des Menschen betonten. Vor allem bei Blaise Pascal führte die Begegnung mit dieser Art gelebten Christentums zu dem, was spätere Autobiografen seine »erste Bekehrung« nannten. Blaise Pascal hatte durchaus auch eine an der Bibel und den Kirchenvätern orientierte religiöse Erziehung genossen und die Familie pflegte den konventionellen Katholizismus ihrer Zeit. Nun aber ging es, um mit Gilberte Pascal zu sprechen, darum, »dass die christliche Religion uns verpflichtet, allein für Gott zu leben« (Sellier 1991, 9–10), um eine kompromisslose Religiosität also, die das gesamte Leben beansprucht und ausfüllt. Blaise Pascal beschäftigte sich von nun an intensiv mit den religiösen Auseinandersetzungen der Zeit (vor allem zwischen den Jansenisten und ihren Gegnern, den Molinisten, hauptsächlich Jesuiten, die an der heilsrelevanten Rolle des freien Willens des Menschen festhielten), er las das Hauptwerk des Jansenismus, den berühmten Augustinus des Jansenius, und die Werke des Augustinus selbst.
Allerdings bedeutete diese Hinkehr zur intensiven Beschäftigung mit religiösen Fragen keineswegs – wie manche Gegner behaupteten – eine Abkehr von den Wissenschaften. Zusammen mit seinem Schwager Florin Périer griff er die Experimente des Italieners Torricelli auf, erweiterte und vertiefte sie und erbrachte so den experimentellen Nachweis, dass Effekte, die man bisher auf den postulierten horror vacui, den natürlichen »Abscheu vor der Leere«, zurückführte, mittels des Gewichts der Luft zu erklären waren. Mit seiner Lehre vom Vakuum begab er sich in direkte Gegnerschaft zu René Descartes. Auch auf dem Gebiet der Mathematik setzt er seine Forschungen fort und entwickelt etwa die Idee der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Seit 1647 hatte sich Pascal zusammen mit seiner Schwester Jacqueline wieder in Paris niedergelassen. In dieser Zeit verschlechtert sich sein Gesundheitszustand auch immer mehr. Tatsächlich hatte er seiner Schwester Jacqueline bekannt, bereits seit dem achtzehnten Lebensjahr keinen Tag ohne Schmerzen zugebracht zu haben. Über die Art seiner Erkrankung wird von den verschiedenen Biografen aufgrund der wenigen Anhaltspunkte zu seinen Schmerzen (Unterleibsschmerzen, Lähmungserscheinungen, dazu heftige Kopfschmerzen) spekuliert. Die meisten gehen von einer schweren Erkrankung des Intestinaltraktes, etwa von Darm- und Magenkrebs bzw. -tuberkulose aus. Im Krankenzimmer findet denn auch die Begegnung zwischen den beiden großen Geistern der Zeit, Pascal und René Descartes, statt, bei der es wohl hauptsächlich um das Problem des Vakuums und die von Descartes angenommene feinstoffliche Materie ging.
Die