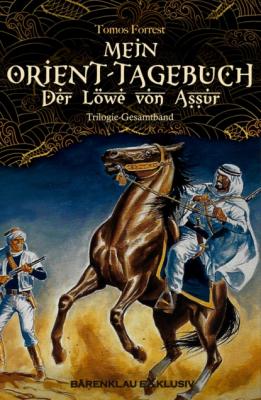Mein Orient-Tagebuch: Der Löwe von Aššur. Tomos Forrest
Читать онлайн.| Название | Mein Orient-Tagebuch: Der Löwe von Aššur |
|---|---|
| Автор произведения | Tomos Forrest |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783754185988 |
„Oh, das erstaunt mich nun wirklich, denn die Hanse ist zwar ein mächtiger Kaufmannbund der Städte an Nord- und Ostsee und im ganzen Binnenland gewesen, aber ich hätte nicht angenommen, dass nun ein Kaufmann in Tunis davon Kenntnis hat.“
Selim lächelte ein wenig gequält, ließ sich sonst aber meine Reaktion nicht weiter anmerken, sondern fuhr fort:
„Eine Reihe von Kaufleuten fand diese Idee, die ich ihnen einst unterbreitete, gut und nachahmenswert – so schufen wir den Schutzbund in ähnlicher Weise für uns neu und wählten als Symbol den Gott für uns aus.“
Ich sah dem Mann in die Augen, aber er hielt meinem Blick stand.
Für mich stand in diesem Augenblick fest, dass Selim Agha ein ausgesprochener Lügner war und die Geschichte mit seinem Bund der Kaufleute uns beruhigen sollte. Andererseits war das Blatt mit dem Symbol, das man Lindsay zugespielt hatte, mit Sicherheit eine Warnung, aber ich behielt meine Meinung für mich.
Wenig später verabschiedeten wir uns, Selim Agha wollte uns am nächsten Morgen von unserem Hotel abholen und persönlich zum Anleger in La Goulette bringen. Das alte Fischerdorf wurde ständig zum eigentlichen Hafen von Tunis ausgebaut, und derzeit fanden wieder einmal Kanalarbeiten zur Lagune von Tunis statt, sodass wir mit einer Droschke über den etwa zehn Kilometer langen Damm fahren mussten, um die Jacht zu erreichen. Unter französischer Herrschaft wurde die Lagune durch einen breiten Kanal mit dem Meer verbunden, aber kaum fertiggestellt, waren weitere Vertiefungen des ständig wieder versandeten Teils erforderlich.
Das alles wurde besprochen; am anderen Morgen erwartete uns Selim Agha Bey, wie immer mit einem freundlichen Lächeln, an einer Droschke vor unserem Hotel. Mehr zufällig fiel dabei mein Blick auf ein kleines Geschäft gegenüber, und ich war mir sicher, dass dort Suef, der Schatten, stand und uns beobachtete. Ein kleines Stück entfernt bummelten zwei Polizisten die Straße herauf, und ich fasste kurz entschlossen in meine Tasche, zog ein paar Pfundnoten heraus und lief zu den Polizisten, die mich aufmerksam musterten.
„Meine Herren, ich bin gestern hier im Bazar bestohlen worden und habe eben den Dieb wiederentdeckt. Er lauert gegenüber vom Hotel im Eingang eines Basars, der kleine Schmächtige mit dem angeschmuddelten Hemd. Er hat mir nur eine wertlose Zigarettendose entwendet und ich möchte Sie bitten, ihn festzunehmen. Dieses Geld ist die Belohnung, die ich auf seine Ergreifung ausgesetzt habe.“
Verblüfft starrten die Polizisten in die angezeigte Richtung, als sich Suef plötzlich in Bewegung setzte und in die andere Richtung eilte.
Mehr war nicht erforderlich, die beiden Polizisten setzten zu einem Spurt an, und als ich die Droschke bestieg, konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Die beiden kräftigen Männer hatten den schmächtigen Suef gepackt und fesselten ihn. Das alles konnte auch Selim Agha Bey nicht entgehen, aber er zeigte eine gleichmütige Miene und tat, als ginge ihn das alles nichts an.
7. Kapitel
Die Morning Star machte einen guten und soliden Eindruck, unsere Kabinen waren großzügig, die Mannschaft mit ihrem Kapitän sahen nicht wie eine Bande von Küstenpiraten aus, was ich, ehrlich gestanden, schon halb befürchtet hatte. Kapitän Arash, ein großer, schlanker Perser mit einem kühn geschnittenen, offenem Gesicht, das durch einen sorgfältig ausrasierten Bart noch gewann, schien ein Mann zu sein, dem man zutrauen konnte, das Schiff auch durch große Stürme hindurch sicher zu lenken.
Er begrüßte uns freundlich, aber nicht devot, und Lindsay nickte ihm zu, als würde es sich um einen alten Bekannten handeln. Die Mannschaft bestand aus einem bunten Völkergemisch aller Hautfarben, darunter auch zwei breitschultrige Nubier, deren mächtige Oberarme ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Kraft waren.
Selim Agha Bey verabschiedete sich unter zahlreichen Verbeugungen, und als er am Kai stand und einen letzten Blick zu uns heraufwarf, bevor die Jacht ablegte, huschte etwas wie Häme über sein sonst stets freundlich lächelndes Gesicht.
Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen, Selim!, dachte ich und blickte zum Bug des Schiffes, der sich eben zum offenen Meer drehte. Wir hielten auf die Halbinsel Cap Bon mit der kleinen Stadt El Haouaria zu und verließen schließlich den Golf von Tunis, um an der Küste entlang, Tripolis, unser nächstes Ziel, anzusteuern.
Die Fahrt entlang der Küste verlief etwas eintönig und ruhig, hatte aber für uns den großen Vorteil, dass wir jederzeit in eine Bucht einlaufen konnten, um dort zu ankern und die Nacht sicher zu verbringen. Das taten wir am zweiten Abend in der Nähe der kleinen Ortschaft Hiboun, wo wir eine geradezu idyllisch gelegene Bucht fanden. Das Wasser war kristallklar, man konnte von Bord aus bis auf den Grund schauen. Während in der geräumigen Kombüse das Abendessen für uns bereitet wurde, nutzte ich die Gelegenheit für ein ausgiebiges Bad, schwamm und tauchte in der Bucht wohl eine halbe Stunde lang, bis sich das längliche Gesicht mit der unglaublich langen Nase meines englischen Reisegefährten über der Reling sehen ließ und er zu mir herunterrief:
„Hallo Master, sind Euch schon Kiemen gewachsen? Ich hätte jetzt ein wenig Hunger, das Essen ist bereit!“
„Komme sofort!“, rief ich zurück und kletterte gleich darauf das Fallreep hinauf, das man eigens zu diesem Zweck für mich angebracht hatte. Wenig später war ich erfrischt und umgezogen auf dem Deck und setzte mich zu Lindsay an den kleinen Tisch, den man für uns dort aufgestellt hatte. Verführerischer Duft aus einer abgedeckten Schale schlug mir hier entgegen, und als ich den Deckel lüftete, floss mir buchstäblich das Wasser im Munde zusammen. Es gab Fisch mit Couscous, sehr delikat gewürzt und ein wahrer Genuss. Unser Koch verstand sein Handwerk, das stellten wir beide anerkennend fest.
Als die Sonne mit der in diesen Breitengraden üblichen Schnelligkeit hinter dem Horizont versunken war, saßen wir noch beim Licht einer Petroleumleuchte an Deck und genossen den Blick auf den Abendhimmel, rauchten und tranken dazu Tee. Gegen elf Uhr verabschiedeten wir uns und suchten unsere Kabinen auf, in denen sich allerdings die Tageshitze noch hielt. Ich öffnete deshalb eines der Bullaugen, hängte das Moskitonetz über mein Bett und verzichtete darauf, mir selbst nur ein dünnes Laken überzudecken.
Durch ein zunächst unerklärliches Geräusch wachte ich auf und sah mich in meiner dunklen Kabine um. Was mich geweckt hatte, schien sich nicht zu wiederholen, wohl aber waren jetzt andere Geräusche auf dem Deck, mehrfach schienen Füße heftig aufzutreten. Ich griff meinen Revolver, öffnete die Tür und wollte gerade über den unbeleuchteten Gang zur Treppe, als auch Lindsay seine Tür öffnete.
„Was ist da oben los, Master?“, erkundigte er sich mit gedämpfter Stimme. In der einen Hand hielt er eine Laterne, in der anderen ebenfalls einen Revolver.
„Jetzt scheint dort ein Kampf stattzufinden, rasch hinauf!“, gab ich zurück, denn gerade war ein dumpfer Laut zu hören, als würde ein Körper auf das Deck schlagen. Jemand stöhnte laut, dann brach der Ton ab.
In dem Moment streckte ich behutsam meinen Kopf aus dem Niedergang und erkannte zwei Gestalten, die auf dem Deck miteinander kämpften. Sie stießen nur kurze Keuchlaute aus, dann hob einer der beiden Kämpfer den anderen plötzlich hoch über den Kopf und warf ihn im hohen Bogen über die Reling.
Mit dem Platschen des Körpers klang etwas anderes durch die Dunkelheit zu mir herüber. Hinter mir tauchte ein weiterer Gegner auf, und im fahlen Mondlicht erkannte ich einen geschwungenen Säbel, der im nächsten Augenblick auf mich herniedersausen würde. Rasch hob ich den Revolver und schoss.
Mit einem gurgelnden Laut kippte mein Gegner nach hinten und schlug auf das Deck.
„Nicht schießen, Sidi (Herr)!“, vernahm ich die Stimme des Mannes, der eben den anderen über Bord geworfen hatte. Das Licht der Laterne erfasste den riesigen Mann, in dem ich jetzt einen der beiden Nubier erkannte, der einen arabischen Dialekt sprach, wie er in der Umgebung von Tunis üblich war. Er stand mit erhobenen Händen vor uns und fletschte jetzt so stark seine Zähne, dass ich das Weiße schimmern sah. Kein Zweifel, der Mann gehörte zur Mannschaft und hatte wohl eben seinen Gegner kurzerhand ins Meer geworfen.
„Was ist hier passiert?“, erkundigte ich mich, während Lindsay mit seiner Lampe