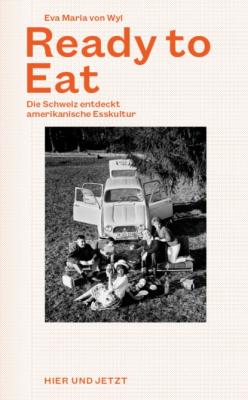Ready to Eat. Eva von Wyl
Читать онлайн.| Название | Ready to Eat |
|---|---|
| Автор произведения | Eva von Wyl |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783039199037 |
Nach der Jahrhundertwende werden zwei weitere Aspekte der Konserve bedeutsam: Erstens eigneten sich ihre Eigenschaften als stapelbare und lang haltbare Ware nicht nur hervorragend für den Transport, sondern auch für die aus den USA stammende, neue Vertriebsart im Selbstbedienungsladen und Supermarkt. Dort konnten die bereits in der Fabrik abgewogenen und abgepackten Dosen mühelos in Regalen gestapelt werden, von wo sie die Kundinnen und Kunden bequem in den Einkaufskorb legen und am Schluss an der Kasse bezahlen konnten. Zweitens wird die Verpackung in diesem Kontext zu einem zentralen Moment und stellt einen Meilenstein in der Ernährungsgeschichte dar. Denn weil die Büchse den Blick auf die Nahrung versperrte, kam der Gestaltung der Etikette und der Verpackung eine zentrale Rolle zu. Als «stumme Verkäufer»22 ersetzen sie den Händler, der die Ware auf dem Markt anpries und bei Bedarf Auskunft geben konnte. Martin Schärer folgert, dass die Etikette damit zum «wichtigen Bestandteil des Produktes» wurde, denn: «sie benannte und erläuterte den Inhalt der Verpackung, erwähnte deren Grösse und Preis, gab Hinweise über die Verwendung und bezeichnete den Hersteller, der die Qualität garantierte.»23 Die Verpackung der Konserve musste aber nicht nur informieren, sondern besonders auch ansprechend und funktional gestaltet sein, weshalb oft der Inhalt auf der Verpackung abgebildet wurde. Die Verpackung und die Etikette wurden so zum eigentlichen Werbeträger, der gerade bei der Selbstbedienung über den Kauf oder Nichtkauf entscheiden konnte.
Damit ist bereits der nächste Entwicklungsschritt angesprochen: die Geburt und der Aufstieg des Markenartikels.24 Weil mit der industriellen Herstellung und der Selbstbedienung ein Prozess der Anonymisierung und der Entfremdung von Produzent und Endverbraucher, aber auch von Verkäufer und Käufer Einzug hielt, galt es, das Vertrauen der Konsumenten auf einer anderen Ebene zu gewinnen. Der Markenartikel versprach durch seine serielle, standardisierte Verarbeitung eine immer gleich bleibende Qualität.
Dass dieses Versprechen bei Weitem nicht immer eingehalten wurde, zeigen verschiedenste Fälle des Etikettenschwindels und der Nahrungsmittelfälschungen, die das durch die Marke hergestellte Vertrauen wieder zerstörten. Gerade bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts stellten Etikettenschwindel und Fälschungen ein echtes Problem dar. Weil zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitere grundlegende und als gesund geltende Bestandteile der Nahrung wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zwar identifiziert waren, aber bis in die 1930er-Jahre noch keine Aussagen über deren Menge in der Nahrung und über deren Aufnahme im Körper gemacht werden konnten, eigneten sich diese geruch- und farblosen Bestandteile hervorragend als Werbeargumente. Die Lebensmittelindustrie konnte im Prinzip über ihre Produkte behaupten, was sie wollte.25 Oftmals wurden den Nahrungsmittelkonserven auch unerlaubte oder gar giftige Substanzen zugefügt, sei es zur Streckung, zur optischen Aufbesserung durch Farbstoffe oder auch als (chemische) Konservierungsmethode. Auch Ge schmacksverstärker, oft in Form von Zucker, wurden relevant, womit die in Zusammenhang mit der Industrialisierung kritisierte Entfremdung von natürlichem Geschmack und Aussehen angesprochen ist.
Nahrungsmittelfälschungen und Etikettenschwindel waren in der jungen Lebensmittelindustrie stark verbreitet; jedoch waren sie keine neuen Phänomene. Im 20. Jahrhundert gerieten insbesondere Konservierungs- und Farbstoffe in die Kritik, was dazu führte, dass Nahrungsmittelgesetze eingeführt beziehungsweise verschärft wurden.26
Auch auf der Konsumentenseite kann die Konserve zur Veranschaulichung für eine Reihe von Veränderungen herangezogen werden, die sich ähnlich wie bei der Produktion durch Rationalisierung und Zeiteinsparung auszeichnen. Dadurch, dass die Zubereitung und Vorbereitung der Lebensmittel in die Fabrik verlegt wurde, rückten das sogenannte Convenience food und die Fertiggerichte ins Zentrum – beides war zuerst in der Dose erhältlich. Die Industrie übernimmt dabei eine Reihe von Aufgaben, für die traditionellerweise die heimische Küche zuständig war. Angefangen bei der Ernte, übernimmt sie das Putzen, Rüsten, Kochen und Würzen. Dabei gibt es verschiedene Abstufungen der Verarbeitung. Gemüsekonserven sind verhältnismässig einfaches Convenience food. Sie bestehen lediglich aus einem, vielleicht zwei Nahrungsmitteln, die gerüstet und vorgekocht werden und von den Endverbrauchern nur noch aufgewärmt werden müssen. Büchsenravioli hingegen sind viel komplexer, sie stellen fixfertige Gerichte dar. Die Herstellung ist sehr aufwendig und geschieht kaum mehr vollständig in einem Haushalt. Zunächst müssen Teig und Füllung hergestellt werden, anschliessend wird beides zu kleinen Teigtaschen verarbeitet. In einem weiteren Arbeitsschritt werden sie gar gekocht, und eine Sauce wird zubereitet. Erst dann kann beides kombiniert und serviert werden. Bei Büchsenravioli geschehen alle diese Arbeitsschritte bereits in der Fabrik. Die Ravioli kommen fixfertig mit Tomatensauce vermischt in die Dose und müssen zu Hause nur noch erhitzt und eventuell mit Käse verfeinert werden – schon ist ein komplettes Menü auf dem Tisch: Ready to eat.
Schliesslich lässt sich anhand der Konserve auch der Übergang vom Luxusgut zum Massenprodukt aufzeigen. Die Nahrungskonserve, die anfänglich als Luxusgut gehandelt wurde, konnte im Verlauf der Industrialisierung dank Transportrevolution, technischen Fortschritten und Rationalisierung immer günstiger produziert werden. Allerdings war die Verbilligung häufig auch mit der Verwendung von preisgünstigeren Surrogaten und damit mit Täuschung verbunden. In Europa vermochte sich die Dosenkonserve – wie viele andere Konsumgüter – erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchzusetzen, während sie in den USA bereits nach der Jahrhundertwende zum Massenkonsumgut avancierte.
Von Birchers Müesli zu Kellogg’s Cornflakes: Reformen in Europa und den USA
Obwohl sich, wie oben skizziert, seit dem Industriezeitalter die Ernährungslage in Europa wesentlich verbessert hatte und dank landwirtschaftlicher Produktivitätssteigerung, leistungsfähigeren Verkehrsnetzen, neuen Produktionstechnologien, naturwissenschaftlichen Fortschritten und neuen Konservierungstechniken Versorgungsengpässe seltener wurden, war die Kost in Europa, aber auch in den USA bis ins 20. Jahrhundert hinein bei Weitem nicht immer ausreichend. Gerade bei den tieferen Schichten in den Städten konnte trotz Nahrungsmittelüberfluss eine Mangelernährung festgestellt werden, wobei unter Mangel nun nicht mehr primär das Fehlen von Nahrung, sondern insbesondere das Fehlen von Nahrungsbestandteilen gemeint war. Gerade in den USA, wo im Vergleich zu Europa seit je Nahrung in Fülle vorhanden war und wo es kaum zu Versorgungsengpässen kam,27 schlug sich dieses Phänomen ab 1912 in einem Begriffswechsel nieder: Aus under-fed wurde under-nourished oder malnourished.28
Auch in der Schweiz war eine ähnliche Entwicklung zu beobachten, wobei hierzulande im Unterschied zu den Vereinigten Staaten kriegs- und krisenbedingte Versorgungsengpässe hinzukamen. Wie bei Schärer nachzulesen ist, zeigte die erste Ernährungsbilanz in der Schweiz von 1910, dass die Schweizer Bevölkerung vor dem Ersten Weltkrieg im Durchschnitt «grad ausreichend» ernährt war. Schärer schreibt: «Dies bedeutet, dass die Nahrung ärmerer Bevölkerungsschichten nicht immer genügte» beziehungsweise dass «gewisse Risikogruppen unter- und mangelernährt» waren.29
Die Mangel- und Fehlernährung breiter Bevölkerungsschichten war – wenn nicht durch Knappheit bedingt – häufig auf einseitige und ungesunde Essgewohnheiten und auch auf Fälschungen oder verminderte Qualität zurückzuführen. Dies rief verschiedene Ernährungsreformer auf den Plan. Meist aus der (gebildeten) Mittel- und Oberschicht stammend, kritisierten sie die Entfremdung von Natur und Nahrung und die (neue) Unkenntnis der Herkunft und der Produktion der täglichen Kost. Mit den unterschiedlichsten Konzepten und Theorien und nach den jeweils neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen versuchten sie die Ernährungsmuster der Massen und besonders der Unterschicht zu steuern und zu verbessern