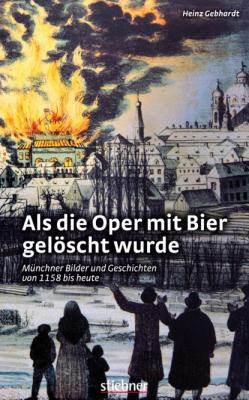Als die Oper mit Bier gelöscht wurde. Heinz Gebhardt
Читать онлайн.| Название | Als die Oper mit Bier gelöscht wurde |
|---|---|
| Автор произведения | Heinz Gebhardt |
| Жанр | Книги о Путешествиях |
| Серия | |
| Издательство | Книги о Путешествиях |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783830730125 |
In den Epochen davor findet man Bier nur in den Klöstern, wo es allerdings nicht öffentlich ausgeschenkt, sondern von den Mönchen selbst getrunken wurde. Alkoholische Getränke waren zur Zeit der Gründung Münchens um 1158 der süße Honigwein »Met« oder saurer Wein aus den Weingärten an den Isarhängen bei Harlaching, Bogenhausen, Wolfratshausen und Schäftlarn, wo alte Straßennamen noch an den einstigen Weinbau erinnern.
1810 232 Hektoliter Bier beim ersten Oktoberfest
Mit der schrecklichsten Oktoberfest-Legende hat der ehemalige Stadtarchivdirektor Richard Bauer schon vor Jahren aufgeräumt, trotzdem geistert in gedruckter Form immer wieder die fürchterliche Mär herum, es hätte auf dem ersten Oktoberfest gar kein Bier gegeben! Die hier abgebildete Radierung von Wilhelm von Kobell zeigt auf dem ersten Oktoberfest 1810 klar und deutlich drei Bierzelte, die zwar nicht so hießen, aber in denen Bier ausgeschenkt wurde zusammen mit Wein und Brotzeiten jeder Art. Es waren die Zelte der »Traiteurs«, den Partygastronomen der Biedermeierzeit, denen ausdrücklich der Ausschank von Wein und Bier erlaubt war. Das zweite Märchen, dass die Münchner damals hauptsächlich Wein getrunken hätten anstatt Bier widerlegen städtische Akten: Beim Weiterfeiern auf dem Marienplatz, der Neuhausergasse und auf dem Promenadeplatz wurden 232 Hektoliter Bier ausgeschenkt und nur 4 Hektoliter österreichischer Weißwein. Dies muss an erster Stelle gesagt sein, denn das große Münchner Volksfest zu Ehren der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Therese von Sachsen-Hildburghausen am 12. Oktober 1810 ohne eine Maß Bier – unvorstellbar! Hauptereignis war natürlich das große Pferderennen, das Unteroffizier Baumgartner zu Ehren des Brautpaares am 2. Oktober im Innenministerium vorgeschlagen hatte. Schon am 4. Oktober wurden dafür gedruckte Einladungen verschickt – unglaublich, wie schnell Ministerien damals entschieden – oder lag eine solche Volksbelustigung als Nationalfest schon in der königlichen Luft? »Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen den Nationalcharakter aus, der sich auf Kinder und Kindes-Kinder vererbt«, sagte Kronprinz Ludwig bei der Eröffnung des ersten Oktoberfestes, wohlwissend, wie sehr ein solches Volksfest die Leute vereint.
Das erste Oktoberfest 1810 mit deutlich sichtbaren ersten Bierzelten rechts oben, Radierung von Wilhelm von Kobell
1818 Münchens erste Bierkönige
Die heutigen Münchner Großbrauereien entstanden alle zu Beginn des 19. Jahrhunderts und oft nach dem gleichen Muster: Armer Brauerlehrling heiratet reiche Brauerstochter.
PAULANERBRÄU: Franz Xaver Zacherl (1772–1849)
Zacherl lernte als Koch, heiratete 1796 die reiche Bauerstochter Elisabeth Schmeder und kaufte mit deren Mitgift 1797 die Hallerbrauerei. 1806 konnte er das von Graf Montgelas im Zuge der Säkularisation aufgelöste Paulanerkloster pachten, in dem immer noch Bier vom ehemaligen Klosterbruder Peter Ludwig gesotten wurde, der das Handwerk vom legendären Bruder Barnabas gelernt hatte. 1813 hatte er mit seinem Paulanerbräu so viel verdient, dass er das ganze Anwesen kaufen konnte.
PSCHORRBRÄU: Joseph Pschorr (1770–1841)
Joseph Pschorr kam als 16-jähriger von Kleinhadern nach München und lernte beim Oberkandlerbräu das Biersieden. 1793 heiratete er die Brauerstochter Therese Hacker vom Hackerbräu. Als 1806 mit den Montgelas-Reformen die Exportbeschränkungen des Münchner Bieres aufgehoben wurden, war Pschorr der erste, der Bier in großem Umfang auch außerhalb Münchens verkaufte und damit den Grundstein zur Großbrauerei legte.
SPATENBRÄU: Gabriel Sedlmayr (1772–1839)
Gabriel Sedlmayr war Brauerssohn aus Maisach. Nach einer Lehre im Münchner Hofbräu kaufte er 1807 die kleinste der 52 Münchner Brauereien, den schäbigen »Oberspaten«. Mit einem Darlehen seines Vaters vervierfachte er in einem einzigen Jahr den Bierausstoß und knallhart rechnend baute er seine Kleinbrauerei mit ständig neuen Krediten zur Großbrauerei aus.
v.l.n.r.: Gabriel Seldmayr (Spatenbräu), Maria Theresia Wagner (Augustinerbräu), Franz Xaver Zacherl (Paulanerbräu), Joseph Pschorr (Pschorrbräu), Georg Brey (Löwenbräu)
LÖWENBRÄU: Georg Brey (1784–1885)
Georg Brey stammte aus Murnau und lernte Bierbrauen beim Wagnerbräu. 1810 wurde er Braumeister beim Grafen Törring in Seefeld am Pilsensee und heiratete die reiche Brauerstochter Anna Rapolt aus Inning. 1818 kauften sie mit ihren Ersparnissen eine kleine Brauerei in der Löwengrube und bauten sie in den nächsten 30 Jahren zu einer der größten Münchner Brauereien aus.
AUGUSTINER: Maria Theresia Wagner (1794–1858)
Die Müllerstochter Maria Theresia Brunner heiratete 1818 Anton Wagner, mit dem sie die Hasüber-Brauerei in Freising kaufte. 1829 übernahmen sie in München das durch die Säkularisation frei gewordene Brauhaus der Augustiner-Mönche. Nach dem frühen Tod ihres Mannes vergrößerte sie die Brauerei und konnte 1857 das heutige Brauereigelände in der Landsberger Straße kaufen.
1823 Großbrand im Nationaltheater mit Hofbräu-Bier gelöscht
Der Januar 1823 war einer der kältesten Wintermonate im 19. Jahrhundert und alle Löschteiche in München waren zugefroren. Da brach während einer Aufführung der komischen Oper »Die beiden Füchse« von Étienne-Nicolas Méhul hinter der Bühne ein Feuer aus, das rasch um sich griff, wodurch das erst 1818 erbaute Nationaltheater fast völlig zerstört wurde. »Während das Parterre noch nicht ganz geleert war, loderten schon große Feuermassen aus den obersten Fenstern des Gebäudes zum Himmel empor. In kürzester Zeit ergriff der Brand das ganze Haus, weithin war die Gegend beleuchtet«, schrieb der Chronist in das Jahrbuch der Stadt.
König Max I. beklagte sich später, dass die Münchner nur gaffend herumstanden und keine Anstalten machten, beim Löschen mitzuhelfen, aber womit denn auch? Sogar die Berieselungsanlage des Ingenieurs Georg von Reichenbach war eingefroren. Allerdings war bei den Schaulustigen eine heimliche Freude über das Feuer verbunden, denn viele sahen den Brand als gerechte Strafe von oben für den Abriss eines Franziskanerklosters, das auf Befehl von Graf Montgelas dem Erdboden gleich gemacht wurde und auf dessen Gelände nun das neue Opernhaus Platz hatte. Schon 1817 war der Dachstuhl in Flammen aufgegangen und es kursierten anonyme Flugblätter mit den Worten »Brand oder Brot« – doch eine Brandstiftung konnte niemandem nachgewiesen werden.
Brand des Nationaltheaters in einer zeitgenössischen Darstellung
In der Brandnacht 1823 standen in der Residenz König Max I., Kronprinz Ludwig und Baumeister Leo von Klenze am Fenster und hier soll den dreien die Idee gekommen sein, die Bierfässer vom nahegelegenen Hofbräuhaus zu beschlagnahmen und damit zu löschen! Ob auf Befehl oder freiwillig: Das Hofbräubier rollte an, »indem die Bierbrauer ihr auf der Kühle liegendes Bier zum Brande führten«, wie ein Bericht der Brauerinnung vermerkt. Genützt hat’s nicht viel und die Oper brannte zur Hälfte nieder. Auch beim Wiederaufbau spielte Bier eine Rolle: Um ihn zu finanzieren, wurde ab März 1823 auf jede Maß Bier ein »Bierpfennig« erhoben und Leo von Klenze konnte das Theater wieder in alter Pracht errichten, so dass es am 2. Januar 1825 zum zweiten Mal eröffnet wurde.
1837 Wie Äquator zum Starkbier wurde
Paulaner-Gründer Franz Xaver Zacherl hatte als erster die Idee, zur Fastenzeit ein Starkbier auszuschenken, allerdings zum Ärger der übrigen Münchner Brauereien, die ihn mit Anzeigen und Drohungen wegen seines