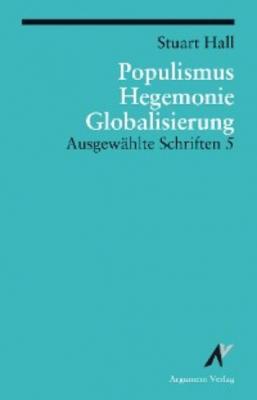Populismus, Hegemonie, Globalisierung. Stuart Hall
Читать онлайн.| Название | Populismus, Hegemonie, Globalisierung |
|---|---|
| Автор произведения | Stuart Hall |
| Жанр | Журналы |
| Серия | |
| Издательство | Журналы |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783867548564 |
Der Staatsapparat
Ein besonderes Merkmal des modernen Staates, das die Vorstellung vom Staat als ›öffentlicher Gewalt‹ kennzeichnet, ist die Ausweitung des institutionellen Staatsapparates – der »sich vergrößernde Apparat der bürokratischen Kontrolle«, der »ausgeprägte Machtapparat« in Skinners Worten. Es gab eine lang anhaltende Debatte darüber, ob die Begriffe ›Regierung‹ und ›Staat‹ austauschbar sind. Das komplexe Wesen des Staates kann nicht auf die Weisen reduziert werden, mittels deren die institutionelle Maschinerie der Regierung funktioniert. Der Staat umfasst eine viel größere Bandbreite an Aufgaben als die technischen und administrativen Fragen, wie die Maschinerie der Regierung arbeitet. Die Begriffe ›Regierung‹ und ›Staat‹ beziehen jeweils sehr unterschiedliche Bedeutungsebenen ein. Andererseits sollte der Staat eine abstrakte und allgemeine Kraft sein, muss seine Macht materialisiert werden – d. h. er muss eine wirkliche, konkrete, gesellschaftliche Organisationsform mit realen Aufgaben erlangen; er muss über reale Ressourcen verfügen und sie gebrauchen können, mittels einer Reihe von Verfahren in den Apparaturen der modernen Staatsmaschine. Dies zeichnet die Macht des modernen Staates mit weiteren besonderen Merkmalen aus: das Phänomen der Bürokratie und die Formung eines rational-technischen administrativen Ethos einer Regierung im großen Stil. Staatsapparate erwerben eigenständige politische und strategische Ausprägungen. Sie können eine Machtbasis für recht verschiedene Interessen werden, mit einer eigenen, ›relativ autonomen‹ Effektivität in Bezug auf die Handlungsweise des Staates.
Staat und Gesellschaft
Bislang haben wir erwogen, was der Staat ist. Nun müssen wir zum Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft übergehen. Wo enden die Grenzen des Staates und wo beginnen die der Gesellschaft? Wie sind die Beziehungen zwischen ›Staat‹ und ›Gesellschaft‹ zu verstehen?
Der Staat geht mit öffentlichen Angelegenheiten einher – res publica: Gesellschaft, insbesondere in der liberalen Tradition, ist verknüpft mit dem Privaten. Mit öffentlich ist alles gemeint, was direkt vom Staat besessen, organisiert oder verwaltet wird. Das Private ist alles, was außerhalb der direkten Kontrolle des Staates liegt; also das, was freiwilligen, nicht vorgeschriebenen Arrangements überlassen wird, die von privaten Individuen organisiert werden. Es gibt in der modernen Gesellschaft zwei durch und durch ›private‹ Sphären. Eine ist die Familie: Persönliche, familiäre, emotionale und sexuelle Beziehungen wurden lange als eine ›häusliche‹ Angelegenheit betrachtet, in die der Staat sich nicht einmischen sollte. Die Familie mit ihrer Autorität, die üblicherweise nur dem männlichen Haushaltsvorstand zugestanden wurde, wurde früher als Modell für den Staat angesehen: der Herrscher als ›Vater seines Volkes‹. Die häusliche Sphäre wurde lange wie ein Himmel betrachtet: ein ›Ort der Zuflucht aus der öffentlichen Welt‹. Die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat hat eine spezifische geschlechtliche Prägung angenommen: das Öffentliche ist die Sphäre der Arbeit, Autorität, Macht, Verantwortlichkeit, der Gestaltung der Welt durch Männer; das Private ist das ›häusliche Reich‹, in dem Frauen und weibliche Tugenden herrschen. Diese Unterscheidung gründet demnach auf einer bestimmten geschlechtlichen Arbeitsteilung und ist eines der wesentlichen Mittel, mit dem der Ausschluss von Frauen aus öffentlichen Angelegenheiten begründet und abgesichert wurde. Die Aufrechterhaltung des Trennungszusammenhangs öffentlich/privat durch den Staat wird zuweilen zu Hilfe genommen, um die patriarchale Schlagseite des Staates zu veranschaulichen.
Die andere ›private‹ Sphäre in liberalen Gesellschaften ist die der Wirtschaft und des Freihandels. In der Zeit des Merkantilismus nahm der Staat im Wirtschaftsleben eine stark direktive Rolle ein. Aber mit der zunehmenden Bedeutung einer privat getragenen kapitalistischen Wirtschaft – auf der Grundlage von Privateigentum und Lohnarbeit, Kapitalverkehr und Marktgesetzen – setzte sich auch zunehmend die Auffassung durch, dass der Staat ›die Wirtschaft in Ruhe lassen‹ sollte (laissez-faire), den Marktkräften erlauben sollte, ohne Staatseinmischung zu wirken, und die Regulierung des Wirtschaftsverkehrs allein den privaten Individuen überlassen sollte, die hierfür freiwillige Verträge aushandeln. Es waren Adam Smith und die frühen Volkswirtschaftler (und nach ihnen Marx), die für diese gesamte Sphäre der ›privaten‹ wirtschaftlichen Aktivitäten in kapitalistischen Gesellschaften den Begriff bürgerliche Gesellschaft prägten.
Diese Abgrenzung ist allerdings beileibe nicht mehr so konturenscharf, wie sie einst war. Beachte die ›öffentlichen Schulen‹, die aber privat gegründet wurden! Dies stellt einen anderen Gebrauch des Begriffs ›öffentlich‹ dar im Vergleich zu dem, den wir zuvor erörtert haben. Der zweite Gebrauch kennzeichnet Dinge als ›öffentlich‹, weil sie im ›öffentlichen Raum‹ stattfinden. Sie wurden formell und institutionell gegründet, wie öffentliche Unternehmen; oder sie finden in der Gesellschaft vor den Augen anderer statt, wie öffentliche Versammlungen. Im gleichen Sinne repräsentiert die öffentliche Meinung die Sichtweisen des Volkes – jedoch außerhalb des Bereichs der staatlichen Verfügungsmacht. Der Begriff ›Zivilgesellschaft‹ weitete sich aus, um alle Formen des sozialen Umgangs oder der freiwilligen Vereinigung abzudecken, ob ökonomisch oder nicht – vorausgesetzt, diese Praktiken wurden nicht vom Staat organisiert oder kontrolliert1. In modernen liberal-demokratischen Gesellschaften existiert heute eine Reihe von gemischten oder hybriden öffentlich-privaten Formen.
Diese Verwirrung – öffentlich = Staat und öffentlich = im öffentlichen Raum – entstand im 18. Jahrhundert. Die aufstrebenden Geschäftsleute und Akademiker nutzten ihre Führungsposition und platzierten ihren Einfluss in der Zivilgesellschaft mittels ihrer privaten wirtschaftlichen Interessen und Geschäfte und auch mittels der Einrichtung unzähliger privat gegründeter und kontrollierter freiwilliger Vereinigungen, Clubs, Handelskammern, Forschungsgesellschaften, Bibliotheken, Wohlfahrtsvereine, Fonds, Berufsverbände etc. Diese Aktivitäten stärkten ihre gesellschaftliche Macht und Autorität und zwangen den Staat zunehmend, sie in formaler und ›öffentlicher‹ Weise vermehrt zu berücksichtigen. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass in diesen ›öffentlichen‹ Vereinigungen Männer vorherrschend waren. Es waren vermögende Männer, ›öffentliche Personen‹. Im gleichen Zuge wurden Frauen zunehmend in die ›getrennte häusliche Sphäre‹ abgesondert.
Die Grenzen zwischen ›Staat‹ und ›Zivilgesellschaft‹ waren nie festgeschrieben, sondern ständig im Wandel. Öffentlich und privat sind keine natürlichen, sondern gesellschaftlich und historisch konstruierte Teilungen. Eine der Weisen, mittels der der Staat seine Reichweite ausdehnte, war das Ziehen neuer Grenzen zwischen öffentlich und privat und damit auch die Neuaufstellung der Definition des Privaten, was das Intervenieren des Staates in Bereiche legitimierte, die bisher als unantastbar galten.
Ist der Staat autonom gegenüber der Gesellschaft?
Auch wenn die ›Separiertheit‹ des Staates von der Gesellschaft in den verschiedenen Staatsapparaten der Regierung und der Staatsmaschine institutionalisiert ist, heißt das deswegen nicht, dass der Staat von der Gesellschaft unabhängig ist. Wenn der Staat unabhängig wäre, dann wäre er gänzlich außerhalb des Spiels gesellschaftlicher Kräfte und Verhältnisse und triebe sich selbst an. Tatsächlich entspringt der Staat der Gesellschaft und wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihn umfassen, machtvoll geformt und beschränkt. Zur gleichen Zeit stellt der Staat selbst ein organisiertes und verdichtetes Kräfteverhältnis dar, ausreichend separiert, um in die Gesellschaft in seinem Sinne zurückzuwirken, in sie zu intervenieren und sie zu formen.
Deshalb das relationale Wesen des Staates: Der Staat steht in kontinuierlicher Interaktion mit der Gesellschaft; er reguliert, ordnet und gestaltet sie. Wir haben bereits die Notwendigkeit betont, dass der Staat den Gehorsam seiner Untertanen verlangen oder ihnen ihre Pflichten auferlegen muss. Aber wir haben auch gesagt, dass dieser Prozess ›Zustimmung‹ einschließt – die allgemeine Bereitschaft der Bevölkerung, trotz vieler Vorbehalte die staatliche Herrschaft zu unterstützen und mit ihr konform zu gehen. In liberalen Demokratien wurde diese Zustimmung genau genommen durch das Wahlrecht und eine repräsentative Staatsführung formalisiert, auf der Grundlage einer territorial bestimmten Wählerschaft (hinzu kommen gewisse rechtsdefinierte soziale und Bürgerrechte). In diesem Fall helfen die Bürger, den gesetzgebenden