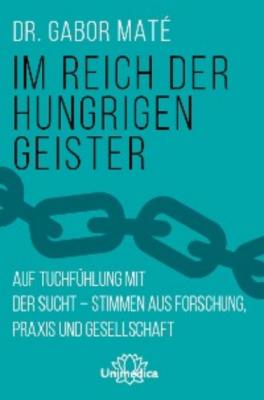Im Reich der hungrigen Geister. Gabor Mate
Читать онлайн.| Название | Im Reich der hungrigen Geister |
|---|---|
| Автор произведения | Gabor Mate |
| Жанр | Здоровье |
| Серия | |
| Издательство | Здоровье |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783962572174 |
„Ich bin froh, dass Sie gekommen sind“, sagt er mir. „Daniel war auch da. Wir hatten ein gutes Gespräch.“ Zu dieser Zeit war mein Sohn Daniel als Mitarbeiter für psychische Gesundheit im Portland angestellt. Er besuchte Ralph als Musiker und Songschreiber im Krankenhaus, und die beiden nahmen zusammen fast eine Stunde lang Lieder von Bob Dylan auf. Dabei spielt und zupft Daniel auf seiner Gitarre zu Ralphs rohem, kratzigem Halbbariton. Als Sänger beherrscht Ralph die Melodien erstaunlich unsicher, aber er hat ein Gespür für die emotionale Resonanz von Dylans Texten und seiner Musik.
„Ich entschuldige mich für das, was ich zu Daniel gesagt habe, und ich entschuldige mich bei Ihnen, für den ‚Arbeit macht frei‘-Mist.“
„Ich bin neugierig. Was bedeutet das alles für Sie?“
„Es geht nur um Überlegenheit. Ich glaube sowieso nicht daran. Keine Rasse ist einer anderen überlegen. Vor Gott sind alle Menschen gleich … es ist sowieso egal. Es sind nur Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Ich bin im Umfeld des Nationalsozialismus aufgewachsen, so wie Sie auch, nur dass Sie sich auf der anderen Seite befanden. Das war eine unglückselige Situation. Ich entschuldige mich für alles, was ich gegen Sie und Ihren Sohn gesagt habe. Ich wünsche mir echt, bald hier raus zu sein, damit Daniel und ich mehr Musik machen können.“
„Wissen Sie, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass es Sie isoliert. Ich schätze, Sie haben gelernt, in der Welt zurechtzukommen, indem Sie extrem feindselig waren.“
„Ich schätze, das stimmt.“ Wenn Ralph emotional bewegt ist, so wie jetzt, wölbt sich die Haut über seinen Unterarmmuskeln wie bei einem Beutel voller Murmeln. „Denn die Leute haben mich schlecht behandelt und … und man lernt, sie auch schlecht zu behandeln. Das ist eine der Möglichkeiten. Es ist nicht der einzige Weg …“
„Das ist ziemlich normal“, sage ich. „Und manchmal kann ich selbst auch ziemlich arrogant sein.“
„Super. Alles, was ich wirklich will … Es ging immer um die Drogen. Ich wollte kein Morphium … Ich wollte Xylocain. Das hätte all meine Probleme gelöst … Es hätte nichts mehr gegeben, wonach es mich gedrängt hätte, nichts, wonach ich auf der Suche gewesen wäre. Es hätte alles gelöst.“
Ralph erklärt auf sehr komplizierte Weise, wie man Xylocain, ein Lokalanästhetikum, zur Inhalation vorbereitet, indem man es mit Backsoda und destilliertem Wasser mischt. Die erhitzte Mischung wird durch ein Stück Scheuerschwamm aus Edelstahl eingeatmet. Er legt großen Wert auf die Inhalationstechnik, bei der, seiner Ansicht nach, die Substanz am Ende langsam durch die Nase ausgeblasen werden muss. Ich höre diesem außergewöhnlichen Vortrag in angewandter Psychopharmakologie fasziniert zu.
„All diese Leute in der Hastings Street und Pender Street und in Downtown Eastside blasen es durch den Mund aus. Das ist lächerlich. Es hat überhaupt keine Wirkung. Um es richtig zu verstoffwechseln, muss es durch die Drüsen der Nasenschleimhaut ins Gehirn gelangen. Wenn es das Gehirn erreicht, wird es verstoffwechselt und blockiert die kleinen Kapillaren, die zu den Gehirnzellen führen …“
„Was empfinden Sie, wenn Sie das tun?“
„Es befreit mich von meinen Schmerzen und meiner Angst. Es nimmt mir meinen Frust. Es gibt mir die reine Essenz des Homunkulus … Sie wissen schon, des Homunkulus im Faust.“
In Goethes epischem Drama ist der Homunkulus ein kleines, in einem Laborkolben erdachtes Wesen aus Feuer. Es ist eine männliche Figur, die sich freiwillig mit dem weiten Ozean, dem göttlich-weiblichen Aspekt der Seele, vereinigt. Nach den mystischen Traditionen aller Glaubensrichtungen und Philosophien ist es ohne eine solche Ego-auflösende Unterwerfung unmöglich, spirituelle Erleuchtung zu erlangen, „den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt“. Ralph sehnt sich nach nichts weniger.
„Der Homunkulus“, fährt er fort, „ist die Figur, die all das verkörpert, was ich gewesen wäre, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so zu sein. Aber die hatte ich nicht. Deshalb nehme ich jetzt Xylocain, wenn ich es kriegen kann, oder Kokain, wenn ich es nicht bekomme.“
Ralph hofft, durch das Rauchen einer Glaspfeife einen friedlichen Bewusstseinszustand zu erlangen. „Ich kann nicht der Homunkulus sein“, sagt er, „daher muss ich ein Süchtiger sein.“
„Wie lange hält dieser Effekt an?“, frage ich.
„Fünf Minuten“, sagt er. „Es sollte nicht vierzig Mäuse kosten, nur um den Schmerz für fünf Minuten abzutöten. Und für fünf Minuten Atempause schlage ich mich auf der Hastings Street herum, rauf und runter, rauf und runter, spreche mit meinen Kumpels und erpresse etwas Geld von ihnen. ‚Hör zu, Kumpel, her mit dem Geld, sonst kriegst du einen mit meinem Stock übergezogen.‘„
Unter dem Laken zittert Ralphs nach zwei Monaten Ruhe und Krankenhauspflege etwas voller gewordener Bauch vor Vergnügen, als er von seinem haarsträubenden krummbeinigen Banditentum erzählt. „Meine Kumpel lachen und geben mir ein paar Münzen. Ich habe eine Menge Freunde. Und ich bettle auch. Aber ich muss stundenlang da draußen herumhetzen, nur um den Schmerz für fünf Minuten zu betäuben.“
„Also sind Sie stundenlang beschäftigt, um fünf Minuten lang Erleichterung zu bekommen.“
„Ja, und dann gehe ich wieder raus, und wieder und wieder.“
„Was ist das für ein Schmerz, den Sie abtöten wollen?“
„Zum Teil ist er körperlich, zum Teil emotional. Körperlich auf jeden Fall. Wenn ich etwas Kokain hätte, würde ich jetzt aus diesem Bett steigen und draußen eine Zigarette rauchen.“
Ich sehe, dass Ralph einen vorübergehenden Nutzen aus seinem Drogenkonsum zieht, und sage es ihm auch. Aber erkennt er nicht die negativen Auswirkungen auf sein Leben? Er ist jetzt seit zwei Monaten im Krankenhaus, nachdem er kurz vor knapp eingeliefert worden war, ganz zu schweigen von seinen Zusammenstößen mit dem Gesetz und dem ganzen anderen Elend.
„All die Zeit und Energie, die Sie aufwenden müssen, um diesen fünf Minuten nachzujagen – ist es das wert? Seien wir ehrlich, die Art und Weise, wie Sie jetzt mit mir sprechen, ist ganz anders als wie Sie sich in Downtown Eastside gebärden, wenn Sie Drogen nehmen, wenn es Ihnen schlecht geht und Sie unglücklich und feindselig sind. Sie provozieren die ablehnende Haltung der Menschen Ihnen gegenüber. Vielleicht ist es nicht Ihre Absicht, aber so ist es. Es hat eine enorme negative Wirkung. Sind es diese fünf Minuten wert?“
In seinem gegenwärtigen drogenfreien Zustand und in seiner freundlichen Stimmung bringt Ralph kein Argument hervor. „Ich verstehe, was Sie sagen, und ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Ich bin die Dinge stumpfsinnig angegangen …“
„Ich würde es nicht einmal stumpfsinnig nennen“, antworte ich. „Ich denke, Sie sind die Dinge so angegangen, wie Sie es gelernt haben. Ich vermute, dass die Welt Sie von frühester Kindheit an nicht sehr gut behandelt hat. Was ist mit Ihnen geschehen? Was hat Sie so defensiv gemacht?“
„Ich weiß nicht … Mein Vater. Mein Vater ist ein gemeiner, mieser Mensch, und ich hasse ihn abgrundtief.“ Ralph spuckt die Worte aus. Unter dem Laken zittern seine Beine heftig. „Wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, den ich verabscheue, dann ist es dieser Mann, der … mein Vater sein musste. Ach, es ist egal. Er ist jetzt ein alter Mann, und er kann für seine Verbrechen nicht mehr büßen, als er es bereits getan hat. Er hat schon tausendmal dafür bezahlt.“
„Ich glaube, das tun alle.“
„Ich weiß“, knurrt Ralph. „Ich habe auch für meine Verbrechen bezahlt. Sehen Sie mich an. Ich kann ohne diesen blöden Stock nicht mal laufen. Ich will fliegen und hänge am Boden fest, weil … Irgendwann erzähle ich es Ihnen …“
Dann beginnen wir, über etwas anderes zu reden. Ralph übt eine kluge, intuitive und scharfsinnige Kritik an der alltäglichen menschlichen Existenz und an der gesellschaftlichen Besessenheit von Zielen, die sich seiner Meinung nach nur wenig von seinem eigenen Streben nach Drogen unterscheidet. Ich erkenne in seiner Analyse eine unbequeme