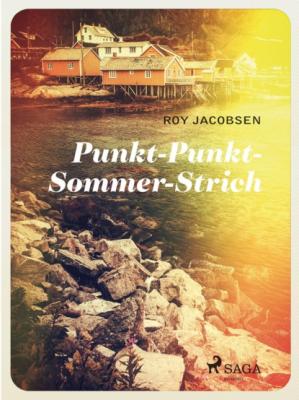Punkt - Punkt - Sommer - Strich. Roy Jacobsen
Читать онлайн.| Название | Punkt - Punkt - Sommer - Strich |
|---|---|
| Автор произведения | Roy Jacobsen |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788711451953 |
Am Rande dieser tiefen existentiellen Schnörkel kräuselt sich nun mein Gehirn, und das so intensiv, daß ich die Schreibmaschine verlassen und ins Wohnzimmer hinuntergehen und fragen muß, ob ich beim Yatzi mitspielen kann. Was sie gestatten. Meine Frau sieht mich leicht mißtrauisch an: »Was soll das bedeuten, du haßt doch Yatzi!«
Ganz richtig, aber jetzt möchte ich lieber hier sitzen, als mich von einer Vergangenheit ablenken zu lassen, die nicht mir gehört, sondern dem Haus, in dem ich wohne – und ein Haus ist ein Haus, es ist einfach nur ein Haus, eine Schale, es ist nichts. Aber ich trete zu einem Zeitpunkt in das Spiel ein, als der älteste Sohn des Spielgerätemannes, Petter, gerade dreimal hintereinander gewonnen hat, weshalb die anderen alles satt und untereinander signalisiert haben: Jetzt ist Schluß.
»Ach?« sage ich.
»Tja, wir könnten vielleicht noch eine Runde machen.«
Eine Wohltätigkeit, von der ich natürlich nichts wissen will, und deshalb erhebe ich mich von dem Stuhl, den ich eben so keß eingenommen habe, gehe in die Küche, reiße die Kühlschranktür auf und schnappe mir wütend ein Bier, als ob ich irgendwem im Kühlschrank Vorwürfe machen könnte, öffne das Bier und trinke, noch immer stocksauer. Und als Katrine kommt und fragt, was das Theater denn bedeuten soll, sage ich wie aus der Pistole geschossen:
»Wenn es morgen auch wieder regnet, fahre ich in die Stadt, ich muß im Verlag etwas erledigen.«
»Ja?«
Meine Frau weiß natürlich genug vom Verlagsleben, um sich darüber im klaren zu sein, daß ein Schriftsteller erst etwas in seinem Verlag zu suchen hat, wenn er sein Werk vorgelegt hat; mit anderen Worten, sie begreift, daß ich ihr einen Vorwand geliefert habe, nur nicht, warum.
»Was ist eigentlich los mit dir, John?«
»Ich brauche einen Tag in der Stadt. Willst du mir das verbieten?«
»Was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Ich verbiete dir doch nichts, solange du nicht die Geliebte treffen willst, von der du geredet hast.«
Und als sie das sagt, geht mir auf, daß ich Katrines große Stärke unterschlagen habe, nämlich ihre Erotik. Sie ist die wunderbarste Eva, die der Herr erschaffen hat. Wenn sie einen Mann liebt – und zwar hoffentlich mich –, dann bringt sie zum Ausdruck, daß diese Episode einzigartig ist, ein pures Wunder in ihrem ehrlich gesagt recht farblosen Leben. Und sie macht es auf eine Weise, die mich daran glauben läßt, jedesmal. Ja, ich habe in keiner einzigen Minute in unserer Zeit als Ehepaar, bis daß der Tod uns scheide, auch nur den geringsten Verdacht gehabt, sie könnte mich mit einem gespielten Orgasmus betrügen oder Phantasien zu Hilfe nehmen, die, nach allem, was ich mir angelesen habe, oft das Geheimnis hinter den geschrienen Vorstellungen zu sein scheinen, die Frauen zwischen den Laken hinlegen. Und der Grund, aus dem ich das hier anbringe, wo es nicht hingehört, ist, daß ich genau das denke, als Katrine diese kleine Ironie über meine potentielle Geliebte serviert, meine Frau, die die Kunst beherrscht, drei Wochen lang erotisch tot zu sein, um dann plötzlich zum reinen Johannisfeuer aufzulodern, und das, wie alle verstehen werden, stellt den Verfasser dieser Zeilen, der nur den Einkauf der Zeitung und seiner Tüte Gummibärchen als physische Aktivitäten vorweisen kann, auf eine wahre Mannestumsprobe, denn sie sagt ihren kleinen Satz mit dem neckenden doppelten Boden und dem seligen Blick, die gerne solchen märchenhaften Nächten vorausgehen.
Ich:
»Ich muß nur kurz in die Stadt, Katrine, einfach so ...«
»Das verstehe ich doch. Fahr du nur.«
»Ist das dein Ernst?«
»Natürlich ist das mein Ernst.«
Der Schriftsteller setzt sich, er setzt sich an den Küchentisch, hört, wie sich die Yatzispieler unter dem Balken verabschieden, an dem vor fünfundzwanzig Jahren Kapitän Schou-Nilsen hing, und wie sie das Haus verlassen, das derselbe Schriftsteller in seinem Tran gemietet hat.
4
In diesem vierten Kapitel sitzt zu Anfang derselbe Schreiberling hinter dem Lenkrad seines sieben Jahre alten Volvo Kombiwagens und schämt sich über den Auftritt von gestern abend. Ich hätte doch einfach sagen können, daß ich in die Stadt fahre, punktum – man ist doch nirgendwo gefangen, weder in der Ehe noch in einem Mietshaus. Aber es ist eben so mit mir, daß ich die geringste Lust, mein Daheim zu verlassen, als Verrat empfinde, auch wenn ich gar nicht vor habe, irgendwen zu betrügen, sondern nur einige Stunden lang durch die Straßen schlendern, Gesichter sehen, in einem Buchladen herumstöbern, in einem Straßencafé ein Mineralwasser trinken möchte ... Ich muß mich gewissermaßen durch irgendeinen krankhaften Zustand retten, mich nahezu zum Genesenden ernennen, der auf eine Weise diese unschuldigen Ausflüge verdient. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, um mich noch mehr zu quälen als unbedingt nötig, hat der Herr diesen Tag mit idiotisch funkelndem Sonnenschein ausgestattet – ja, die Sonne scheint, aber ich fahre trotzdem!
»Natürlich fährst du«, sagt Katrine. Sie hält also mein Gerede vom Regen für puren Quatsch. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste ist, daß ich sie natürlich betrügen werde, nicht so, wie der Leser vermutlich hofft, sondern, indem ich vorhabe, ganz unschuldig in die Universitätsbibliothek zu gehen und Zeitungen vom September 1967 zu lesen. Und warum will ich meine Frau nicht in diese Pläne einweihen? Nun, egal, wie offen wir in diesem Mordfall miteinander umzugehen beschlossen haben, und ungeachtet der Tatsache, daß wir gleich viel oder gleich wenig wissen, so muß jeder neue Schritt in der Entwicklung auf die Goldwaage gelegt werden. Ich kann Katrine einfach keiner Information aussetzen, die sie, wie ich meine, beunruhigen wird. Meine Pflicht, sie zu beschützen, ist natürlich viel grundlegender als schwebende ideologische Begriffe wie »Ehrlichkeit« und »Aufrichtigkeit«. Und deshalb ruht, als Kapitel vier sich dahinschleppt, der Fuß des Schriftstellers fest auf dem Gaspedal, der Tacho liegt bei achtzig, wie es sich hierzulande gehört, und der Arm des Schriftstellers ruht im Fenster. Friede herrscht in dem Zipfel des Königreichs Norwegen, durch das er gleitet, es ist Sommer, und es ist üppig, heiß und bürgerlich. Ich sause über Mosseveien, vorbei an Ulvøya, wo ich als Kind kurzfristig gewohnt habe, vorbei an Malmøya und Bekkelaget, und ich entdecke das große Lagerhaus, das schönste Bauwerk Norwegens, und beschließe noch einmal, an der Sabotage des weiteren Lebens im Norden weiterzuarbeiten.
Dann muß ich einer Menge von neuen Ausfahrten und Tunnels ausweichen und erreiche über einige kleine Umwege die Universitätsbibliothek auf dem Solli Plass. Mineralwasser, Straßencafés, Freunde und Buchläden sind also in den Hintergrund gedrängt worden, denn hier betrete ich das tiefste Gedächtnis der Nation, in dem alle Idiotien, die Norweger im Laufe der Zeit zu Papier gebracht haben, griffbereit versammelt sind. Aber jetzt, wo die Sonne scheint, interessiert die Gegenwart sich nicht für Erinnerungen, zum Glück, denn auf diese Weise bin ich fast allein in der Zeitungsabteilung, nur eine junge Frau, eine Studentin mit Rattenschwänzchen und einer Rockmode, die ich seit satten zwanzig Jahren für ausgestorben hielt, leistet mir Gesellschaft. Sie liest Zeitungen aus den Kriegstagen, während ich mich auf die verschiedenen Lokalzeitungen des Distrikts konzentriere, auf Ausgaben von prähistorischen und längst ausgestorbenen Arten, sowie einige Nummern von Aftenposten.
Sämtliche Publikationen können erzählen, daß in Schweden nunmehr rechts gefahren wird, daß der Schah im Iran vorhat, seine Fahra Diba in allernächster Zukunft krönen zu lassen, daß mein alter Kollege Arthur Omre kürzlich verschieden ist, daß der Vietnamkrieg aufs ärgste wütet. Und fast als kleine Ironie der Geschichte gerade für mich, für den Schriftsteller persönlich, gibt Morgenposten am 2. September 1967 auf der Seite »Vermischtes« eine kleine kommunistische Anekdote zum besten: Der ehemalige russische Fürst Felix Jussulow gibt in Paris auf seinem Sterbebett konspiratorische Interviews, der Mann, der seinerzeit, das heißt, 1916, am russischen Zarenhof den Ränkeschmied Rasputin ermordete und damit einen der größten Betrüger der Geschichte unschädlich machte, ohne selber ebenso berühmt zu werden. Eine Köpenickiade, über die der Verfasser dieser Zeilen in seiner Jugend einst seine Diplomarbeit schreiben wollte, damals, als er noch den Ehrgeiz hatte, Historiker zu werden, was er bald wieder aufgab, als