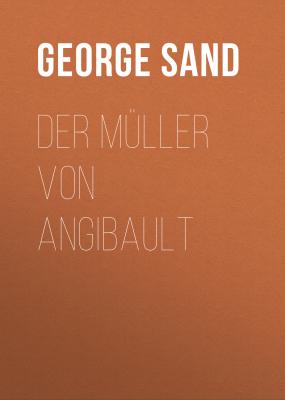Der Müller von Angibault. Жорж Санд
Читать онлайн.| Название | Der Müller von Angibault |
|---|---|
| Автор произведения | Жорж Санд |
| Жанр | Зарубежная классика |
| Серия | |
| Издательство | Зарубежная классика |
| Год выпуска | 0 |
| isbn |
Heinrich ließ sein Haupt auf Marcelles Knie sinken und verharrte so einige Augenblicke, wie vor Freude und Dankbarkeit außer sich, aber bald wieder fuhr er heftig auf und die tiefste Verzweiflung malte sich auf seinen Zügen.
»Haben Sie denn in der Ehe nicht allzu traurige Erfahrungen gemacht?« fragte er mit einer Art von Härte, »und wollen Sie sich noch einmal unter das Joch beugen lassen?«
»Sie flößen mir Furcht ein«, sagte Frau von Blanchemont nach einem Augenblick schreckhaften Stillschweigens. »Verspüren Sie denn in sich tyrannische Gelüste oder fürchten Sie für sich das Joch einer ewigen Treue?«
»Nein, nein, nichts von alledem«, versetzte Lemor niedergeschlagen. »Was ich fürchte, ist, dass es mir unmöglich, Sie oder mich selbst zu unterwerfen. Sie wissen es: aber Sie wollen, Sie können das nicht verstehen. Wir haben hierüber so viel gesprochen zu einer Zeit, wo wir nicht im Entferntesten daran dachten, dass diese Erwägungen eines Tages uns persönlich angehen, ja dass sie für mich eine Lebensfrage werden würden.«
»Ist’s möglich, Heinrich? Bis zu diesem Grade hätten Sie sich in Ihre Utopien verrannt? Wie, selbst die Liebe sollte diese Chimären nicht beilegen können? Ach, wie schwach ist eure Liebe, ihr Männer!« setzte sie mit einem tiefen Seufzer hinzu. »Im Falle nicht das Laster eure Seelen austrocknet, so tut es die Tugend, und immerfort, möget ihr nun elende oder erhabene Charaktere sein, liebt ihr nur euch selbst.«
»Hören Sie mich, Marcelle. Wenn ich Sie vor Monatsfrist gebeten hätte, Ihre Grundsätze zu vergessen, wenn meine Liebe von Ihnen das erfleht hätte, was Ihre Religion und Ihr Glaube Sie als eine ungeheure unsühnbare Schuld ansehen ließ —«
»Sie haben das nicht gefordert, Heinrich«, unterbrach ihn Marcelle errötend.
»Weil ich Sie viel zu sehr liebte, um Sie um meiner willen leiden und weinen zu machen. Aber wenn ich es getan hätte, Marcelle, antworten Sie doch, wenn ich es getan?«
»Diese Frage ist unzart und gar nicht am Platze«, versetzte sie, sich zu einer Bewegung voll liebenswürdiger Koketterie zwingend, um der Antwort auszuweichen. Ihre Grazie und Schönheit machten Lemor erbeben. Er presste sie leidenschaftlich an sein Herz. Aber sogleich wieder diesem Moment der Trunkenheit sich entreißend, erhob er sich und wiederholte, heftigen Schrittes vor der Geliebten auf und ab gehend, mit erhöhter Stimme:
»Und wenn ich Sie jetzt bäte, mir dieses Opfer zu bringen, welches der Tod ihres Gatten plötzlich ungefährlich, weniger schrecklich, weniger furchtbar gemacht?«
Frau von Blanchemont wurde blass und ernsthaft und versetzte:
»Heinrich, dieser Gedanke muss mich notwendig im tiefsten Herzensgrund beleidigen und verwunden, in dem Augenblick, wo ich Ihnen meine Hand anbiete und Sie dieselbe auszuschlagen scheinen.«
»Ich bin doch recht unglücklich, mich nicht verständlich machen zu können und für einen Elenden angesehen zu werden, gerade dann, wenn ich den ganzen Heroismus der Liebe in mir fühle. Dies Wort wird Ihnen ehrsüchtig vorkommen und muss Sie mitleidig lächeln machen. Und doch ist es wahr … und Gott wird mir einst in Rechnung bringen, was ich leide … es ist entsetzlich … es übersteigt vielleicht bald meine Kräfte.«
Und er brach in Tränen aus. Der Schmerz des Jünglings war ein so tiefer und ehrlicher, dass Frau von Blanchemont erschrak. Es war in diesen heißen Tränen etwas, das einer unbesieglichen Abneigung gegen das Glück, einem Lebewohl für alle die Illusionen der Liebe und Jugend glich.
»O, mein geliebter Heinrich«, rief Marcelle aus, »was für ein Unheil wollen Sie denn über uns beide verhängen? Warum verzweifeln, jetzt, da Sie der Herr meines Lebens sind, da nichts mehr uns hindert, einander vor Gott und den Menschen anzugehören? Oder steht etwa mein Sohn hinderlich zwischen uns? O, Sie haben eine so große Seele, dass Sie wohl einen Teil der Zuneigung, welche Sie für mich hegen, auf ihn übergehen lassen können.«
»Ihr Sohn?« entgegnete Heinrich schluchzend. »Ich hege eine viel gewichtigere Besorgnis, als die, ihn nicht lieben zu können. Ich fürchte, ihn nur allzu sehr zu lieben und nicht ruhig zusehen zu können, wenn er sein Leben in einem von meinen Ansichten abweichenden Sinne verbringt. Sitte und Herkommen würden mich zwingen, ihn der Welt zu überlassen und ich möchte ihn ihr doch entreißen … nein, ich vermöchte ihn nicht mit solcher Gleichgültigkeit und Selbstsucht zu betrachten, um aus ihm einen Menschen werden zu lassen, wie seine Standesgenossen sind; … nein, nein! … Dies und anderes und alles in Ihrer Stellung und der meinigen türmt uns ein unübersteigliches Hindernis entgegen… Von welcher Seite ich immer unsere Zukunft ins Auge fasse, kann ich in ihr nur einen wahnwitzigen Kampf erblicken, Unglück für Sie, Fluch für mich. Es ist unmöglich, Marcelle, für immer unmöglich! Ich liebe Sie zu innig, um von Ihnen Opfer anzunehmen, deren Resultate Sie nicht vorhersehen, deren Ausdehnung Sie nicht ermessen können. Sie kennen mich nicht, ich sehe es wohl, Sie halten mich für einen unentschlossenen und schwachen Träumer. Ich bin aber ein entschlossener und unverbesserlicher Träumer. Sie haben mich vielleicht manchmal der Affektation beschuldigt, Sie haben geglaubt, dass ein Wort von Ihnen hinreichte, mich zu dem zurückzuführen, was Sie für vernünftig und wahr halten. O, ich bin weit unglücklicher, als Sie wähnen, und ich liebe Sie viel heißer, als Sie dermalen begreifen können. Später… ja, später werden Sie mir im Grund ihres Herzens dafür danken, dass ich es verstand, allein unglücklich zu sein.«
»Später? Und warum? Wann denn? Was wollen Sie sagen?«
»Später, sage ich Ihnen, wann Sie erwacht sein werden aus diesem finstern und unseligen Traum, womit ich Sie umsponnen, wann Sie zurückgekehrt sein werden in die Welt und die leichten und süßen Berauschungen derselben teilen, endlich, wann sie nicht mehr ein Engel sein, sondern herabgestiegen sein werden zur Erde!«
»Ja, ja, wann ich werde ausgedörrt sein durch die Selbstsucht und verdorben durch die Schmeichelei. Das wollten Sie sagen, das prophezeien Sie mir! In Ihrem wilden Stolz halten Sie mich für unfähig, Ihre Ideen zu fassen und Ihr Herz zu verstehen. Sprechen Sie das Wort aus: Sie betrachten mich als Ihrer unwürdig, Heinrich!«
»Was Sie sagen ist entsetzlich, gnädige Frau, und dieser Streit darf nicht länger dauern. Lassen Sie mich fliehen, denn wir können uns jetzt nicht verständigen.«
»Und so wollen Sie mich verlassen?«
»Nein, ich verlasse Sie nicht, denn auch fern von Ihnen trage ich Ihr Bild in mir und verwahre es in dem Tabernakel meines Herzens. Ich werde meinen Kummer zu tragen wissen, aber in der Hoffnung, dass Sie mich vergessen werden, mit der Reue, Ihre Zuneigung ersehnt und gesucht zu haben, aber auch mit dem Trost, dass ich diese Zuneigung wenigstens nicht niederträchtig gemissbraucht.«
Frau von Blanchemont war aufgestanden, um den Geliebten zurückzuhalten, allein wie vernichtet fiel sie auf die Bank zurück und sagte, als sie sah, dass er sich entfernen wollte, mit kaltem, beleidigtem Ton:
»Aber weswegen haben Sie mich denn zu sehen verlangt!«
»Ja, ja, Sie haben ein Recht zu diesem Vorwurf. Es ist dies eine letzte Schwachheit von mir. Ich empfand das Bedürfnis, Sie noch einmal zu sehen, und gab ihm nach… Ich hoffte, es werde in Ihren Gefühlen gegen mich eine Veränderung vorgegangen sein, Ihr Schweigen machte mich dies glauben… ich war von Kummer verzehrt und glaubte in Ihrer Kälte die Stärke zu finden, die Fesseln meiner Liebe zu zerbrechen. Warum bin ich gekommen? Warum lieben Sie mich? Bin ich nicht der einfältigste, undankbarste, wildeste, hassenswerteste der Menschen? Aber es ist besser, dass Sie mich so sehen, dass Sie erfahren, Sie hätten meinen Verlust nicht zu bedauern. Es ist besser so und ich tat recht zu kommen… nicht wahr?«
Heinrich hatte dies in einer Anwandlung von Verzweiflung gesprochen, seine ernsten und reinen Züge waren verstört, seine sonst harmonische und sanfte Stimme hatte einen harten, schrillenden Klang angenommen, dass sie dem Ohr wehtat. Marcelle sah seinen Schmerz deutlich, aber ihr eigener war so stechend, dass sie nichts tun oder sagen konnte, was Ihnen gegenseitig Erleichterung verschafft hätte. Bleich und stumm, mit krampfhaft verschlungenen Händen bewegungslos dasitzend, glich sie einer Statue. Im Begriff, sich zu entfernen, wandte sich Heinrich nach ihr um und ihr Anblick ließ ihn zurückkehren, sich zu ihren Füßen werfen und dieselben mit Tränen und Küssen bedecken.
»Lebe