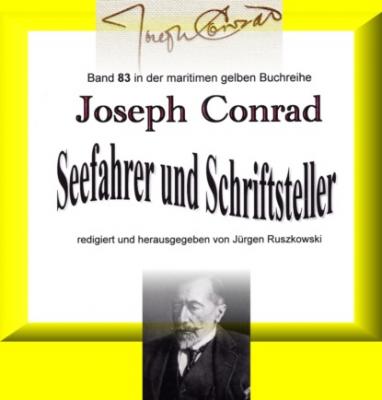Joseph Conrad - Seefahrer und Schriftsteller. Joseph Conrad
Читать онлайн.| Название | Joseph Conrad - Seefahrer und Schriftsteller |
|---|---|
| Автор произведения | Joseph Conrad |
| Жанр | Изобразительное искусство, фотография |
| Серия | |
| Издательство | Изобразительное искусство, фотография |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783738066296 |
„Ich weiß einen Felsen“, flüsterte heimlich die wissende Stimme in der Kapuze. „Aber – Vorsicht! Es muss vorbei sein, ehe unsere Leute merken, was wir vorhaben. Wem können wir jetzt noch trauen? Ein Messerschnitt durch das Fockfall würde die Fock von oben holen und uns binnen zwanzig Minuten um die Freiheit bringen. Und sogar unsere besten Leute könnten Angst vorm Ertrinken haben. Da ist noch das kleine Boot, aber bei einer Sache wie dieser hier kann niemand wissen, ob er gerettet wird.“
Die Stimme brach ab. Als wir von Barcelona absegelten, hatten wir das Dingi im Schlepp; nachher war es zu gewagt, es hereinzuholen, darum hatten wir es am Ende einer tröstlich langen Leine sein Glück mit den Seen versuchen lassen. Manchmal schien es uns schon gänzlich begraben zu sein, aber immer wieder sahen wir es über einer Woge auftauchen und so fröhlich und heil wie immer dahinhüpfen.
„Ich verstehe“, sagte ich langsam. „Sehr gut, Dominic. Wann?“
„Noch nicht. Wir müssen zuerst etwas tiefer hinein“, antwortete die Stimme aus der Kapuze in geisterhaftem Geflüster.
Es war abgemacht. Jetzt hatte ich den Mut, mich umzudrehen. Unsere Leute kauerten mit unruhigen, niedergeschlagenen Gesichtern hier und da an Deck, und alle waren sie unserem Verfolger zugekehrt. Zum ersten Mal an diesem Morgen nahm ich auch Cesar wahr, der sich in voller Länge beim Fockmast auf dem Deck ausgestreckt hatte, und ich überlegte, wo er sich wohl bis jetzt herumgedrückt haben mochte. Aber er hätte wahrhaftig die ganze Zeit neben mir stehen können, und ich wäre seiner doch nicht bewusst geworden. Wir waren zu sehr in unserem Verhängnis aufgegangen, als dass wir noch Aufmerksamkeit füreinander aufgebracht hätten. Niemand hatte an diesem Morgen etwas gegessen, aber die Leute waren ständig zum Trinken ans Wasserfass gekommen.
Ich lief hinunter in die Kabine. Ich verwahrte dort in einer abgeschlossenen Schublade zehntausend Franken in Gold, deren Vorhandensein an Bord, soviel ich wusste, außer Dominic keine Seele im Geringsten ahnte. Als ich wieder an Deck kam, hatte Dominic seine Stellung verändert und schaute unter seiner Kapuze heraus suchend auf die Küste. Kap Creus begrenzte voraus die Sicht. An Backbordseite lag eine weite Bucht; die wütenden Böen hatten ihr Wasser aufgerissen und zerwühlt, es sah aus, als wäre sie voller Rauch. Achteraus zog es am Himmel drohend herauf.
Sowie er mich sah, erkundigte sich Dominic in gelassenem Tone, was geschehen wäre. Ich kam dicht zu ihm, machte ein möglichst unbeteiligtes Gesicht und brachte ihm mit gedämpfter Stimme bei, die Schublade wäre aufgebrochen und der Geldgürtel fort. Gestern Abend war er noch da.
Er zitterte heftig. „Was wollten Sie damit?“ fragte er.
„Ihn umschnallen natürlich“, antwortete ich und erschrak, als ich seine Zähne schnattern hörte.
„Verfluchtes Gold“, murmelte er. „Das Gewicht hätte Sie vielleicht Ihr Leben gekostet.“ Er schauderte. „Wir haben keine Zeit, jetzt darüber zu reden.“
„Ich hin fertig.“
„Noch nicht. Ich warte, dass diese Bö heraufkommt“, flüsterte er. Und einige träge Minuten vergingen.
Schließlich zog die Bö herauf. Unser Verfolger wurde von einem finsteren Wirbelwind überrumpelt und geriet außer Sicht. Die TREMOLINO bebte und hüpfte voran. Das Land voraus verschwand ebenfalls, und wir schienen in einer Welt aus Wasser und Wind alleingelassen zu sein.
„Prenez la barre, Monsieur“, brach Dominic plötzlich mit rauer Stimme das Schweigen. „Übernehmen Sie die Pinne.“ Er beugte seine Kapuze an mein Ohr. „Die Balancelle gehört Ihnen. Von Ihrer Hand muss der Schlag kommen. Ich – ich habe noch ein anderes Stück Arbeit zu tun.“ Laut sagte er zu dem Mann, der steuerte: „Lass den Signorino die Pinne nehmen und halte du dich mit den anderen bereit, aufs Wort das Boot längsseit zu holen.“
Der Mann war überrascht, gehorchte aber stumm. Die anderen gerieten in Bewegung und spitzten die Ohren. Ich hörte sie flüstern: „Was nun? Wollen wir irgendwo an Land gehen und ausreißen? Der Padrone weiß, was er tut.“
Dominic ging nach vorn. Er hielt inne, um auf Cesar herabzusehen, der, wie ich schon sagte, lang ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten beim Fockmast lag; dann trat er über ihn weg und verschwand unter der Fock. Nach vorne sah ich nichts. Es war für mich unmöglich, außer der offenen, stillen Fock, der großen schattenvollen Schwinge, irgendetwas zu sehen. Aber Dominic hatte seine Peilung. In einem eben vernehmlichen Ruf kam seine Stimme zu mir: „Jetzt, Signorino!“
Ich legte die Pinne über, wie er es mir vorher gesagt hatte. Noch einmal hörte ich ihn schwach, und dann brauchte ich nur noch geraden Kurs zu halten. Kein Schiff ist seinem Tode so freudig entgegengelaufen. Es hob sich und sank, als segelte es ins Nichts, und schoss schwirrend wie ein Pfeil voran. Dominic bückte sich unter dem Fußliek der Fock hindurch und kam wieder zum Vorschein. Er blieb in zuversichtlicher, abwartender Haltung mit erhobenem Zeigefinger an den Mast gelehnt stehen. Eine Sekunde vor dem Schlag ließ er den Arm zur Seite niedersinken. Als ich das sah, biss ich die Zähne zusammen. Und dann –
Rede von splitternden Planken und krachenden Spanten! Dieser Schiffbruch liegt mir mit dem Grauen und Entsetzen eines Mordes auf der Seele, mit so unvergessbaren Gewissensbissen, als hätte ich ein lebendiges, treues Herz mit einem einzigen Schlage zermalmt. Im einen Augenblick das Rauschen und die erhabene Schwinge der Schnelligkeit; im nächsten ein Krach, und Tod, Stille – ein Augenblick furchtbarer Reglosigkeit; der Gesang des Windes hat sich in schneidendes Jammern verwandelt, und das schwere Wasser kocht drohend und träge um den Leichnam herum auf. Ich sah in einer erschütternden Minute die Fockrah mit einem brutalen Schwung in Längsschiffrichtung fliegen und die Männer in einem Haufen wie Wahnsinnige und fluchend vor Angst an der Schleppleine des Bootes holen. Mit der seltsamen Empfindung, die stets das Gewohnte willkommen heißt, sah ich auch Cesar unter ihnen und erkannte ich Dommies alte, wohlbekannte, wirkungsvolle Geste, den waagerechten Schwung seines kräftigen Armes. Ich entsinne mich genau, dass ich mir sagte: „Selbstverständlich muss Cesar jetzt zu Boden gehen“, und dann versetzte mir die hin und her fegende Pinne (ich hatte sie losgelassen und war dabei, auf allen Vieren fortzukriechen) einen harten Schlag unters Ohr, der mich ohnmächtig zusammenfallen ließ.
Ich glaube nicht, dass ich länger als ein paar Minuten besinnungslos war, aber als ich wieder zu mir kam, trieb das Dingi vor dem Winde in eine kleine geschützte Bucht; zwei Mann hielten es mit den Riemen nur eben auf Kurs. Dominic saß neben mir auf dem Achtersitz, er hatte einen Arm um meine Schulter gelegt und stützte mich.
Wir landeten an einem wohl vertrauten Teil der Küste. Dominic nahm einen Riemen aus dem Boot mit. Ich glaube, er dachte an den Fluss, über den wir nachher hinweg mussten; es lag da zwar ein elendes Punt, aber der dazugehörige Staken war oft gestohlen. Zuallererst mussten wir jedoch die Hügelreihe im Rücken des Kaps ersteigen. Er half mir hinauf. Mir war schwindelig. Mein Kopf war sehr dick und schwer. Als wir die Höhe erreicht hatten, hing ich nur noch so an ihm und wir hielten an, um auszuruhen.
Die weite, rauchige Bucht unter uns war leer. Dominic hatte Wort gehalten. Kein Span und kein Splitter war mehr um den schwarzen Felsen herum zu sehen, von dem die TREMOLINO, als ein einziger Schlag ihr tollkühnes Herz zerbrochen hatte, in tiefes Wasser zur ewigen Ruhe hinabgeglitten war. Treibende Nebel erstickten die Unermesslichkeit der offenen See, und mitten unter der lichter werdenden Bö jagte der unwissende Guardacosta unter furchtbarem Segelpress wie ein Phantom weiter auf der Verfolgung nach Norden. Unsere Leute kletterten schon den jenseitigen Abhang hinab, um das Punt zu suchen, das, wie wir aus Erfahrung wussten, nicht immer leicht zu finden war. Ich sah mit stumpfen, verschleierten Augen hinter ihnen her. Eins, zwei, drei, vier.
„Dominic, wo ist Cesar?“ schrie ich.
Der Padrone machte, als wollte er den bloßen Klang des Namens abwehren, jene weite, schwunghafte Niederschlagsgeste. Ich trat einen Schritt zurück und starrte ihn erschreckt an. Sein offenes Hemd enthüllte den starken Nacken und das dichte Haar auf seiner Brust. Er stieß den Riemen senkrecht in die weiche Erde, rollte langsam den rechten Ärmel auf und streckte den bloßen Arm vor mein Gesicht hin.
„Dies“, begann er mit äußerster Langsamkeit, in deren übermenschlicher Zurückhaltung