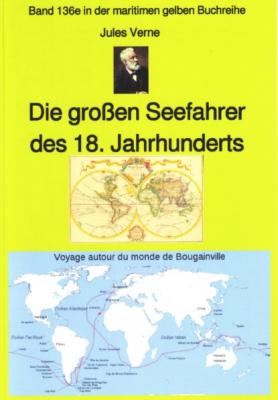Jules Verne: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts - Teil 1. Jules Verne
Читать онлайн.| Название | Jules Verne: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts - Teil 1 |
|---|---|
| Автор произведения | Jules Verne |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | gelbe Buchreihe |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783753192321 |
Die Verzweiflung war entsetzlich, die Bestürzung unaussprechlich. Anson aber, ein energischer und um Auskunftsmittel nie verlegener Mann, wusste seine Leute bald umzustimmen. Noch blieb ihnen eine den Spaniern abgenommene Barke übrig, und diese wollten sie verlängern, um alle Menschen und die nötigen Nahrungsmittel zur Überfahrt bis China aufnehmen zu können. Neunzehn Tage später kehrte die „CENTURION“ zurück, die Engländer schifften sich am 21. Oktober ein und erreichten bald glücklich Macao. Seit zwei Jahren, d. h. seit ihrer Abreise aus England, ankerten sie zum ersten Male in einem befreundeten Hafen!
„Macao“, sagt Anson, „das früher sehr reich, stark bevölkert und im Stande war, sich gegen seine chinesischen Grenznachbarn zu verteidigen, hat von seinem ehemaligen Glanze viel verloren. Obwohl es noch immer von Portugiesen bewohnt und durch einen, vom Könige von Portugal ernannten Gouverneur verwaltet wird, zehrt es doch gewissermaßen von der Gnade der Chinesen, die es leicht aushungern und überwältigen könnten; der Gouverneur hütet sich auch sorgsam, jene zu reizen.“
Anson musste sogar an den nächsten chinesischen Gouverneur einen Drohbrief ablassen, um nur die Erlaubnis auszuwirken, noch dazu gegen sehr hohe Preise, Nahrungsmittel und die nötigste Ausrüstungs-Reserve aufkaufen zu dürfen. Dann machte er öffentlich bekannt, dass er nach Batavia abfahre, und ging am 19. April 1743 unter Segel. Anstatt aber nach den holländischen Besitzungen zu steuern, wendete er sich nach den Philippinen und lauerte daselbst auf die von Acapulco zurückkehrende Gallion, welche ihre Ladung dort gewöhnlich sehr teuer verkaufte. Gewöhnlich führten diese Schiffe 44 Kanonen und 500 Mann Besatzung. Anson zählte bloß 200 Matrosen, darunter etwa nur 30 Schiffsjungen; dennoch erschien ihm das Missverhältnis der Kräfte kein Hindernis, denn ihn reizte die Hoffnung auf reiche Beute, und die Habgier seiner Leute erschien ihm als hinlängliches Unterpfand für deren Kampfesmut.
„Warum“, so fragte Anson eines Tages den Küchenmeister, „warum bringen Sie nichts mehr von den Lämmern, die wir in China kauften, auf die Tafel? Wären diese alle aufgezehrt?“ – „Der Herr Geschwader-Chef möge gütigst entschuldigen“, erwiderte der Gefragte, „noch sind zwei vorhanden, aber ich dachte sie aufzubewahren, um damit den Kapitän der Gallione zu bewirten.“
Niemand, nicht einmal der Küchenmeister zweifelte also an dem erhofften Ausgang. Anson traf übrigens seine Anstalten sehr geschickt und wusste die kleine Zahl seiner Leute durch leichtere Beweglichkeit besser auszunützen. Es entspann sich wirklich ein lebhafter Kampf mit der Gallione; die Matten, mit denen die Schanzkleidung derselben geschützt war, fingen Feuer und die Flammen leckten bald am Fockmast empor. Zwei Feinde auf einmal zu bekämpfen, ward den Spaniern zu schwer. Sie ergaben sich nach zweistündigem Kampfe, der ihnen 77 Tote und 84 Verwundete gekostet hatte.
Die Beute war sehr beträchtlich: „1.313.843 Achter, eine spanische Goldmünze, so genannt, weil sie das Achtfache einer Dublone wertete; etwa M. 8*60 = fl. 4*30 unseres Geldes und 35.682 Unzen Silber in Barren, außer einer Quantität Cochenille und einigen anderen, im Vergleich zu dem Silberfange minder wertvollen Waren. Unter Hinzurechnung des früheren Raubes belief sich die gesamte Beute nun nahezu auf 600.000 Pfund Sterling, ohne die Schiffe, Waren u. s. w. zu rechnen, welche die Engländer den Spaniern verbrannt oder zerstört hatten, und die wohl einen ebenso hohen Wert erreichen mochten.“
Nach seinem Raubzuge lief Anson das Ufer von Kanton an, verkaufte dort die ganze übrige Beute weit unter ihrem Werte für 6.000 Piaster und kehrte nach einer Abwesenheit von drei Jahren und neun Monaten am 15. Juni 1744 nach Spitead zurück. Sein Einzug in London glich einem Triumphzuge. Unter Trommelwirbel und Trompetenton und unter lautem Jubelruf der Volksmenge brachten 32 Lastwagen die auf 10 Millionen geschätzte Beute, welche unter den Offizieren und Matrosen geteilt wurde, ohne dass selbst der König zu einem Anspruch dabei berechtigt war.
Bald nach seiner Rückkehr nach England erhielt Anson die Ernennung zum Kontre-Admiral und übernahm mehrere wichtige Kommandos. Im Jahre 1747 gelang es ihm, nach heldenhaftem Ringen den Marquis La Jonquière-Taffanel gefangen zu nehmen. Nach diesem Erfolge zum ersten Lord der Admiralität und zum Admiral befördert, unterstützte er 1758 den Versuch einer Landung der Engländer bei St. Malo und starb in London bald nach seiner Heimkehr.
* * *
Die Vorläufer des Kapitän Cook
Die Vorläufer des Kapitän Cook
Roggeween. – Dürftige Nachrichten über ihn. –
Unbestimmtheit seiner Entdeckungen. – Die Oster-Insel. –
Die Verderblichen Inseln. – Die Baumans-Gruppe. –
Neu-Britannien. – Ankunft in Batavia. – Byron. –
Aufenthalt in Rio de Janeiro und im Hafen Désiré. –
Eintritt in die Magellan-Straße. –
Die Falklands-Inseln und der Egmont-Hafen. – Die Fuegiens. –
Mas-a-Fuero. – Die Trostlosen Inseln. – Die Inseln der Gefahr. –
Tinian. – Rückkehr nach Europa.
Schon im Jahre 1669 hatte Pater Roggeween der holländisch-westindischen Handelsgesellschaft eine Denkschrift eingereicht, in der er die Ausrüstung dreier Schiffe befürwortete, um damit nach dem Stillen Ozean auf Entdeckung auszuziehen. Sein Plan fand zwar günstige Aufnahme, der Eintritt einer Erkaltung der Beziehungen zwischen Spanien und Holland zwang jedoch die batavische Statthalterschaft, vorläufig von einer solchen Expedition abzusehen. Noch auf dem Sterbebette nahm Roggeween seinem Sohne Jakob das Versprechen ab, den von ihm aufgestellten Plan auszuführen.
Jakob Roggeween
Mannigfache und von seinem Willen völlig unabhängige Umstände hinderten Letzteren lange Zeit an der Erfüllung seines Versprechens. Erst nachdem er wiederholt die Meere Indiens durchsegelt und eine Stelle als Rat bei dem Justizhofe von Batavia bekleidet, sehen wir Jakob Roggeween bei der holländisch-westindischen Compagnie neue Schritte tun. Wie alt er im Jahre 1721 wohl sein mochte und mit welchem Rechte er Ansprüche auf Übernahme der Oberleitung einer Entdeckungs-Expedition erhob, ist nicht bekannt geworden. Die biographischen Lexika widmen ihm meist nur wenige Zeilen, und Fleurieu, der in einem schönen und gelehrten Schriftchen die Entdeckungen des holländischen Seefahrers sicherer zu bestimmen suchen wollte, gelangte in dieser Beziehung zu keinem nennenswerten Resultat. Auch den Bericht über seine Reise hat er nicht einmal selbst abgefasst, sondern ein Deutscher, Namens Behrens. Vielleicht ist für die mancherlei dunklen Stellen, die Widersprüche und den Mangel an Genauigkeit der Erzähler mehr verantwortlich zu machen als der Seemann. Wiederholt scheint es, so wenig das doch vorauszusetzen ist, dass Roggeween von den Reisen und Entdeckungen seiner Vorgänger und Zeitgenossen kaum hinlängliche Kenntnis gehabt habe.
Am 21. August liefen unter seinem Kommando von Texel drei Schiffe aus: die „AIGLE“ mit 36 Kanonen und 111 Mann Besatzung, die „TIENHOVEN“, 28 Kanonen und 100 Mann, Kapitän Jakob Bauman, und die Galeere „DIE AFRIKANERIN“, 14 Kanonen und 60 Mann, Kapitän Heinrich Rosental. Die Fahrt über den Atlantischen Ozean bot kein besonderes Interesse. Nachdem er Rio kurz berührt, suchte Roggeween eine Insel aufzufinden, welche er Auke's Magdeland nennt, das wäre das heutige Maidenland, die Falklands-Inseln oder Malouinen, wenn darunter nicht Georgia australis zu verstehen ist. Obwohl diese Inseln damals genügend bekannt waren, drängt sich doch die Annahme auf, dass die Holländer über deren Lage nicht sicher unterrichtet waren, da sie nach Aufgabe der Untersuchung Falklands sich nach den Inseln St. Louis des Franpais wenden wollten, ohne zu wissen, dass diese zu dem nämlichen Archipel gehörten.
Übrigens gibt es wenige Länder, welche mehr Namen geführt haben als diese, wie z. B. auch den der Pepys- oder Conti-Inseln, nebst noch manchen anderen. Es wäre leicht, ein ganzes Dutzend Bezeichnungen zusammenzustellen.
Nachdem