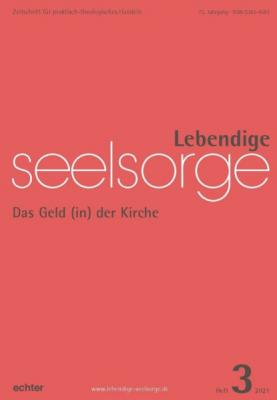Lebendige Seelsorge 3/2021. Verlag Echter
Читать онлайн.| Название | Lebendige Seelsorge 3/2021 |
|---|---|
| Автор произведения | Verlag Echter |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783429065096 |
Die Kirche ist entsprechend dann arm, wenn sie der Macht des Geldes entsagt und dieses immer nur im Kontext ihrer Sendung einsetzt. Das mag für eine finanziell ärmere Kirche aus praktischen Notwendigkeiten heraus leichter sein. Eine reiche Kirche läuft hingegen Gefahr, in Bequemlichkeit und mitunter auch Selbstgenügsamkeit zu verharren, die den Blick für die vielfältigen Möglichkeiten des Reichtums einschränken. Der Rückschluss jedoch, dass die Ausrichtung des Vermögens auf die Sendung in einer armen Kirche per se besser gelingt als in einer reichen, ist nicht haltbar.
DIE RÜCKBESINNUNG AUF DIE KIRCHLICHE SENDUNG KANN GELINGEN
Die Zweckbestimmung des gesamten kirchlichen Vermögens muss sich auch im Handeln aller Entscheidungsträger:innen widerspiegeln. Auf Ebene der Diözese kommt dem Bischof die Gewalt über das Vermögen zu. Verwaltet wird es in der Praxis aber vor allem durch den vom Bischof angewiesenen Diözesanökonom (vgl. c. 494 § 3 CIC). Sowohl Priesterrat als auch Konsultorenkollegium (in Deutschland das Domkapitel), Diözesanvermögensverwaltungsrat und Kirchensteuerrat müssen bei gewissen Entscheidungen gehört werden oder haben sogar Zustimmungsrechte. Wird eine entsprechende Genehmigung nicht eingeholt oder nicht erteilt, ist ein Rechtsakt ungültig.
Wer letztlich über den Haushalt entscheidet und wie transparent diese Entscheidungen ablaufen, ist je nach Bistum sehr unterschiedlich.
Durch die verschiedenen Kontrollmechanismen soll sichergestellt werden, dass Geldgeschäfte nicht nur ethischen Kriterien genügen, sondern auch im Sinne der Sendung der Kirche erfolgen. Wer letztlich über den Haushalt entscheidet und wie transparent diese Entscheidungen ablaufen, ist je nach Bistum sehr unterschiedlich. Somit ist auch nur schwer nachvollziehbar, ob die gebotene Zweckbindung ausreichend reflektiert wird. Eine Überprüfung der gebotenen Sorgfaltspflicht (vgl. c. 1284 § 2 CIC) erscheint von außen kaum möglich.
Es ist keine leichte Aufgabe, die Werke des Apostolats und der Caritas zu definieren und ein kirchliches Kerngeschäft abzugrenzen, für das Vermögen verwendet werden kann.
Auf der Ebene der Pfarrei kommt in Deutschland nicht dem Pfarrer, sondern dem Vermögensverwaltungsrat – die Bezeichnungen variieren – das Verfügungsrecht über das Vermögen zu. Er trifft bindende Entscheidungen. Auch hier müssen sämtliche Akte der Vermögensverwaltung zugunsten der Zweckbindung reflektiert werden. Dabei reicht es nicht aus, dies bei anstehenden Entscheidungen zu tun, auch die (im Hintergrund) laufenden Kosten müssen im Blick behalten werden. Es ist notwendig, dass sich die Gremien einen Überblick über das gesamte Vermögen, alle Kosten und Ausgaben verschaffen. Auch ist eine grundsätzliche Vergewisserung, welchen Wert das Geld für die Sendung der Kirche vor Ort hat, für eine gelingende Vermögensverwaltung unabdingbar. Nur wenn Schwerpunkte im Sinne der Sendung getroffen werden, kann Geld seinem Zweck entsprechend verwendet werden.
Eine solche Schwerpunktsetzung muss dabei als fortlaufender Prozess verstanden werden. Bedarfe ändern sich, pastorale Innovationen müssen immer möglich sein und auch mitunter herausfordernde Abschiede von Liebgewonnenem dürfen nicht gescheut werden. Dann erst kann kirchliches Handeln vor Ort nicht nur im Sinne des Vermögensrechts gelingen, sondern zugunsten des kirchlichen Auftrags auch authentisch sein.
ABWÄGUNGEN ERFORDERN (DE-)MUT
Es ist keine leichte Aufgabe, die Werke des Apostolats und der Caritas zu definieren und ein kirchliches Kerngeschäft abzugrenzen, für das Vermögen verwendet werden kann. Um das Vermögen an den Zwecken auszurichten, bedarf es solcher Grenzen, die jedoch immer einer gewissen Dynamik unterworfen sein müssen, damit Kirche in der Welt wirken kann. Denn auch neue den örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten entsprechende Ideen zur Umsetzung des Apostolats müssen möglich bleiben, ganz im Sinne einer ecclesia semper reformanda.
Wie schwierig die Antwort auf die Frage nach dem Zweck sein kann, ist daran zu erkennen, dass zum Vermögen nicht nur das freie Verwaltungsvermögen gehört, das unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, sondern eben auch solches, das dem Erzielen von Erträgen dient und nur mittelbar den kirchlichen Zwecken. Oft ist es das Stammvermögen, das den Anschein erweckt, es bestehe aus reinem Selbstzweck. Es handelt sich hierbei um die bleibende wirtschaftliche Grundausstattung, die eine langfristige Verwirklichung der kirchlichen Zwecke ermöglicht. Das Stammvermögen bzw. dessen Wert ist deshalb grundsätzlich zu erhalten. Da zum Stammvermögen vornehmlich Immobilien gehören und der Umgang mit diesen immer wieder Thema in kirchlichen Debatten ist, lässt sich an ihnen zeigen, wie auch das Stammvermögen einer Prüfung auf die kirchlichen Zwecke hin unterzogen werden kann. Auch wenn das Stammvermögen rechtlich besonders geschützt ist, ist eine Umschichtung zum Beispiel durch den Verkauf einer Immobilie unter gewissen Voraussetzungen möglich. Besonders angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen und der verstärkten Fusion von Pfarreien, müssen Entscheidungen getroffen werden, welche Immobilien tatsächlich noch im Dienst der Sendung der Kirche stehen oder ob die dort (noch) stattfindende Sendung nicht auch gleichwertig an einem anderen Ort durchgeführt werden kann. Auch eine ökumenische Nutzung bietet sich immer öfter an. Eine Entscheidung über den Wert einer Immobilie ist umso drängender, wenn ihr Unterhalt hoch ist und das Geld an anderer Stelle unmittelbarer für Apostolat und Caritas gebraucht wird. Zugleich verdeutlichen solche Abwägungen, dass es bei der Zweckdienlichkeit nicht bloß um die kurzfristige Erfüllung der Sendung gehen darf, sondern dass auch langfristige Perspektiven einbezogen werden müssen.
Neben der Instandhaltung von Immobilien schlagen die hohen Personalkosten in vielen Bistumshaushalten zu Buche. Besonders in den Bistumsverwaltungen sind diese im Verhältnis zu den unmittelbaren Ausgaben für die Seelsorge ‚an der Basis‘ sehr hoch. Dieses Ungleichgewicht geht zurück auf die Einführung der Diözesankirchensteuer in den 1950er Jahren und wird zusehends größer. Vor allem angesichts der sinkenden Zahl an Kirchenmitgliedern, die ‚die Basis‘ ausmachen, besteht hier dringender Handlungsbedarf.
Eine weitere Zuspitzung findet sich in renditeorientierten Investitionen der Kirche. Sie führen nicht selten zu einem schwerwiegenden Verlust an Glaubwürdigkeit. Eine Finanzierung durch Vermögenserträge ist außerdem problematisch, wenn das Geld bei Unternehmen angelegt wird, deren Handeln nicht mit der Sozialverkündigung der Kirche übereinstimmt und somit ihrer Sendung zuwiderläuft (vgl. Wiemeyer, 503f.). DBK und ZdK haben hier mehrfach die Notwendigkeit eines ethischen Investments betont. Nur schwerlich mit den kirchenrechtlichen Vorgaben zu vereinen ist außerdem die Bildung von Rücklagen aus Kirchensteuermitteln. Denn verlangen darf die Kirche von ihren Mitgliedern nur das, was sie notwendig für ihre Sendung benötigt (vgl. c. 1260 § 1 CIC). Ein vieles rechtfertigendes Sicherheitsbestreben entspricht ihr sicher nicht.
Die innerkirchlichen Rechtsfolgen eines Kirchenaustritts wirken der kirchlichen Sendung entgegen.
AUCH DIE KIRCHENSTEUER MUSS SICH AN DER SENDUNG MESSEN
Nicht zuletzt muss sich neben dem Besitz und der Verwendung auch der Erwerb von Vermögen und Geld – in Deutschland geschieht das hauptsächlich durch die Kirchensteuer – an den gebotenen Zwecken und der Sendung der Kirche messen. Viele Gründe sprechen für oder gegen die Kirchensteuer. Mit Blick auf das Ziel der Heiligung der Menschen und der Verbreitung der christlichen Botschaft in der Welt stechen zwei konträre Argumente heraus.
Eine untrennbar mit der Kirchensteuer verbundene Nebenwirkung ist der Kirchenaustritt. Unter anderem bewirkt ein solcher die Verweigerung des Zugangs zu den Sakramenten. Dienen doch eben diese als Zeichen und Werkzeug dem Heil der Menschen, fällt die Diskrepanz zur Sendung der Kirche sofort ins Auge. Die innerkirchlichen Rechtsfolgen eines Kirchenaustritts wirken der kirchlichen Sendung entgegen. Entsprechend muss dieser Aspekt auch Einfluss auf die Diskussion um die Rechtsmäßigkeit des gesamten Kirchensteuersystems haben.
Anders gewendet ermöglicht die Kirchensteuer, dass die Kirche in Deutschland so umfassende