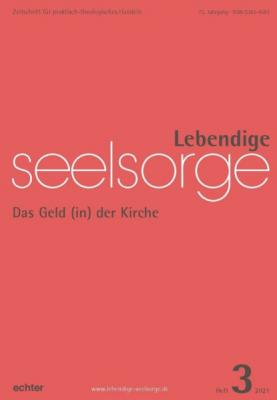Lebendige Seelsorge 3/2021. Verlag Echter
Читать онлайн.| Название | Lebendige Seelsorge 3/2021 |
|---|---|
| Автор произведения | Verlag Echter |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783429065096 |
DILEMMA INNOVATIONS- VS. EINSPARPROZESSE
Unabhängig von einer Umstellung der Verteilung der Kirchensteuermittel sowie von ergriffenen und noch zu ergreifenden Strategien und Maßnahmen wird die Zahl der Kirchenmitglieder und damit auch die Kirchensteuerkraft in den kommenden Jahrzehnten abnehmen. Das führt zwangsläufig zu Einsparprozessen, die im Nachgang der Veröffentlichung der Freiburger Studie teilweise bereits begonnen wurden. Gleichzeitig sind jedoch zusätzliche Investitionen nötig, um zumindest den kirchenspezifischen Faktoren, also dem hausgemachten Teil des Mitgliederrückgangs, zu begegnen und diese abzumildern. Dieses Dilemma zwischen Sparen und Investieren wird sich nur durch einen offenen und ehrlichen Prioritätenprozess auflösen lassen. Wenn dieser transparent, aber konsequent umgesetzt wird, werden ausgediente Konzepte innovativen Projekten weichen. Dann besteht die Hoffnung „Die Sache mit Gott“ (Heinz Zahrnt) mit neuer Energie unter die Menschen zu tragen.
LITERATUR
Gutmann, David/Peters, Fabian, #projektion2060. Die Freiburger Studie zu Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer. Analysen – Chancen – Visionen, Neukirchen-Vluyn 2021.
Wenn das Geld zum Selbstzweck wird
Auftrag und Sendung der Kirche ist es, die Botschaft vom Reich Gottes in die Welt zu tragen. Die Kirche ist Mittel zum Zweck. Auch das kirchliche Vermögensrecht ist geprägt von diesem hohen moralischen Anspruch, auch kirchliches Vermögen ist Mittel zum Zweck. Dennoch wird das Geld in der Kirche immer wieder zum Selbstzweck. Eine Neuausrichtung des kirchlichen Vermögens ist deshalb nicht nur rechtlich geboten, sondern längst überfällig. Anna Ott
Die deutsche Kirche ist reich an Vermögen. Daran hat sie sich gewöhnt. Die sich aus dem Reichtum ergebenden Möglichkeiten sind für die Kirche, ihre Mitglieder, aber auch den Staat und die Gesellschaft längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Gleichzeitig sind die Handlungsspielräume bei der Gestaltung der Haushaltspläne aufgrund der vielen Verpflichtungen deutlich eingeschränkt. Für den Umgang mit Geld, Besitz und Vermögen auf allen Ebenen normiert das Kirchenrecht dabei einheitliche Kriterien.
DAS KIRCHLICHE VERMÖGEN IST STRENG ZWECKGEBUNDEN
Damit die Kirche ihren Auftrag in der Welt – die Verkündigung des Glaubens, die Feier von Gottesdiensten und die Ausübung der Nächstenliebe – erfüllen kann, ist sie angewiesen auf zeitliche Mittel, auf Vermögen in verschiedenen Formen, auf Geld (vgl. Lumen gentium 8; Gaudium et spes 76). Die Kirche ist zwar zu Erwerb, Besitz, Verwaltung und Veräußerung von Vermögen berechtigt, jedoch nicht unbegrenzt. Schon zu Beginn normiert das Vermögensrecht im CIC eindeutig, dass kirchliches Vermögen nur ganz bestimmten Zwecke dienen darf (vgl. c. 1254 § 1 CIC). Da der moralische Anspruch der Kirche, mit dem das Evangelium in die Welt getragen werden soll, hoch ist, ist auch die Zweckbindung des Vermögens streng. Explizit genannt werden drei Zwecke kirchlichen Vermögens, die aufeinander verweisen und aufgrund der gemeinsamen Ausrichtung auf die Sendung der Kirche kaum voneinander zu trennen sind (vgl. c. 1254 § 2 CIC):
Die Durchführung des Gottesdienstes ist der erste dieser Zwecke. Besonders in liturgischen Handlungen ist Christus gegenwärtig. Durch sie antworten die Gläubigen auf Gottes Heilszusage und werden somit selbst geheiligt. Ist das Ziel der kirchlichen Sendung das Heil der Menschen, so ist jedes eucharistisches Opfer zugleich Höhepunkt und Quelle kirchlichen Handelns (vgl. Sacrosanctum Concilium 10). Das Kirchenrecht eröffnet den Raum, in dem dieser Heiligungsdienst der Kirche stattfinden kann. Die Verwendung finanzieller Mittel für den Vollzug des Gottesdienstes, also mindestens für die rechtlich geforderten heiligen Räume und (Einrichtungs-)Gegenstände, ist dementsprechend erforderlich und geboten (vgl. Fischer, 49).
Anna Ott
geb. 1992, katholische Theologin und Studentin im Lizentiat Kanonisches Recht in Münster; promoviert zur Zukunftsfähigkeit der Kirchensteuer im Spannungsfeld zwischen rechtlichen Vorgaben, bewährter Praxis und kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
Daran knüpft der zweite Zweck an: die Sicherstellung des angemessenen Unterhalts des Klerus und anderer kirchlicher Bediensteter. Weder sollen diese wegen ihrer Arbeit für die Kirche in äußerster Armut leben, noch soll das berufliche Engagement mit Geld aufgewogen werden und womöglich zu Überfluss führen (vgl. Fischer, 50). Die Entlohnung ist allein der Sendung der Kirche verpflichtet, in deren Dienst die Entlohnten stehen. Von ihnen wird gleichzeitig verlangt, in der Nachfolge Christi anspruchslos und einfach zu leben (vgl. c. 282 § 1). Dass sich die Vergütung des Dienstes für die Kirche an den Kontexten zu orientieren hat, in denen sie agiert, ist dabei unstrittig (vgl. c. 281 § 1; c. 232 § 2 CIC). So muss die Entlohnung bspw. auch die Bedarfe der Familien der Angestellten decken (vgl. GS 67).
Überschüsse aus Einnahmen sollen zum Wohl der Kirche und für die Werke der Caritas verwendet werden (vgl. c. 282 § 2 CIC), vor allem für die Armen (vgl. GS 69). Bezieht sich dies zwar auf Einkünfte der Kleriker, kann dieser Grundsatz doch insgesamt gelten. Die Finanzierung der Werke des Apostolats und der Caritas unter besonderer Beachtung der Armen ist nämlich der dritte explizite und gleichzeitig der umfassendste Zweck, dem kirchliches Vermögen dienen soll. Gerade die Sorge um die physisch Armen steht in enger Verbindung zu materiellen Gütern, die es gerecht zu verteilen gilt (vgl. Fischer, 67). Apostolat ist hingegen alles, was Christi Herrschaft in die Welt trägt und was den Menschen den Weg der Erlösung zeigt (vgl. Apostolicam actuositatem 2). An dieser vielfältigen Sendung der Kirche in der Welt haben alle Gläubigen teil (vgl. c. 216 CIC). Die Aufzählung dieser drei genannten Zwecke ist nicht erschöpfend. Das Kirchenrecht kennt weitere Zwecke wie die Evangelisierung, Bildung und Erziehung, Arbeit an (Hoch-)Schulen und im Bereich der Medien. Auch sie gehören zum Wesenskern von Kirche und sind somit legitimer Zweck von kirchlichem Vermögen. Zumeist konkretisieren diese weiteren Zwecke die drei explizit genannten, immer jedoch haben alle Zwecke mit der Sendung der Kirche in Einklang zu stehen (vgl. Fischer, 68f.). Durch die Zweckbestimmung werden die nicht verhandelbaren Leitlinien für den Umgang mit kirchlichem Vermögen deutlich. Diese sind vergleichbar mit dem, was betriebswirtschaftlich als ‚Compliance‘ oder ‚Good Governance‘ bezeichnet wird. Zugunsten der Erfüllung der Sendung kann hier jedoch die ökonomische Effizienz in den Hintergrund treten (vgl. c. 1295 CIC).
Das oft postulierte Ideal der Armut bedeutet nicht, dass die Kirche allen finanziellen Möglichkeiten entsagen soll.
EINE ARME KIRCHE MUSS NICHT FINANZIELL ARM SEIN
Das oft postulierte Ideal der Armut bedeutet nicht, dass die Kirche allen finanziellen Möglichkeiten entsagen soll. Schließlich übt sie eine spezifische Sendung aus, die nur erfüllt werden kann, wenn sie sich auf die kontextuellen Rahmenbedingungen einlässt, zu denen auch die Geldwirtschaft gehört. Eine Kirche, die arm ist, verpasst die Gelegenheit, Ungerechtigkeiten auszugleichen und sich den Menschen zuzuwenden, die zum Überleben selbst auf Geld angewiesen sind. Wenn Jesus im Neuen Testament seinen Jüngern aufträgt, allem Besitz zu entsagen, dann geschieht dies immer aus dem Motiv der Nachfolge heraus und nicht, weil der Besitz selbst verwerflich ist. Das wird er nur dann, wenn sich der Mensch an ihn klammert, habgierig und selbstgenügsam wird. Armut meint in diesem Sinne viel mehr die Haltung, mit der mit Besitz und Geld umgegangen werden soll. Der Umgang mit Vermögen hat immer differenziert und selbstkritisch gegenüber der eigenen Sendung zu sein. Das ‚Ob‘