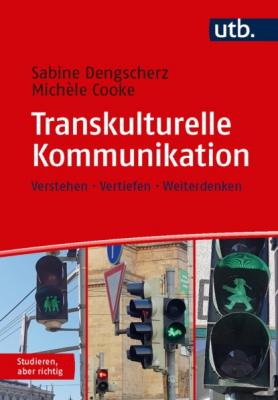Transkulturelle Kommunikation. Michèle Kaiser-Cooke
Читать онлайн.| Название | Transkulturelle Kommunikation |
|---|---|
| Автор произведения | Michèle Kaiser-Cooke |
| Жанр | Социология |
| Серия | Studieren, aber richtig |
| Издательство | Социология |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783846353196 |
Wie verstehen Sie dieses Bild?
Vögel (Foto: pixabay)
Oder anders gesagt: Was verstehen Sie an diesem Bild? Das oben erwähnte Verstehensbedürfnis ist so zwingend, dass wir auch „automatisch“ die Kommunikation zwischen anderen Lebewesen interpretieren. Und dies erfolgt klarerweise von unserer, der menschlichen Perspektive aus. Bei allen Bemühungen, eine anthropomorphe (menschenzentrierte) Sichtweise zu vermeiden, wird es uns schwer gelingen, einen Vogel aus der Perspektive eines Vogels zu betrachten. Wir nehmen zwangsläufig den menschlichen Standpunkt ein.
Diese menschliche Sicht der Vögel im obigen Bild beeinflusst, wie wir das Verhalten der Vögel interpretieren. Wir deuten ihre Körpersprache, die Nähe oder Distanz, die sie zueinander halten, nach menschlichen Kriterien.
Der Vogel links im Bild zum Beispiel steht etwas abseits und nimmt dadurch eine stärkere Position ein als die anderen drei, die als Gruppe ihm zuzuhören scheinen. Auch die Kopfhaltung des links stehenden Vogels – nach oben gerichtet – wirkt bestimmt und sogar leicht überheblich.
Natürlich könnte man viel mehr aus diesem Bild lesen. Allein diese kurze Beschreibung zeigt aber, wie sehr unsere Auffassung des „Inhalts“ eines Bildes oder eines Verhaltens mit dem eigenen Standpunkt zusammenhängt.
Wir sehen auch, dass wir eine Beziehung zwischen den Vögeln annehmen und daraus eine Interpretation ableiten: Die körperliche Nähe (oder Distanz) deutet auf die innerliche (emotionale) Beziehung zueinander hin.
Kommunikation ist in der Tat nicht möglich ohne Beziehung – ohne sich aufeinander zu beziehen. Wenn wir eine Person (oder etwas) wahrnehmen, beziehen wir uns auf sie (bzw. darauf). Wir beginnen, sie (oder es) einzuordnen: Wer ist das? Wie gut kennen wir uns? Ist sie mir sympathisch? etc. In den meisten Fällen erfolgt diese Einordnung unbewusst oder automatisch. Bei Eltern oder Freund*innen zum Beispiel müssen wir uns nicht mehr fragen, wer sie sind oder ob wir sie gernhaben: Wir wissen „automatisch“, wie wir zu ihnen stehen. Und wie wir zueinander stehen, beeinflusst wesentlich die Interpretation des gegenseitigen Verhaltens.
Ein Kind, das seinen Eltern vorschreibt, nicht nach Mitternacht nach Hause zu kommen, wird höchstwahrscheinlich als frech gelten. Die meisten Kinder und Jugendlichen erwarten hingegen, dass die Eltern gewisse Regeln aufstellen, und auch wenn diese lästig sind, würde kaum jemand auf die Idee kommen, solche Eltern als frech zu bezeichnen. Frech ist nur jemand, der die akzeptierte Autoritätsgrenze überschreitet.
Die gleiche Äußerung – „Komm nicht zu spät nach Hause!“ – wird also je nach der Beziehung der kommunizierenden Person und deren Autoritätsverhältnis unterschiedlich interpretiert. Der „Inhalt“ der Äußerung ändert sich dementsprechend: Du bist frech oder Du bist lästig bzw. Typisch Eltern.
Es ist aber nicht nur eine Frage der Autorität. Ob wir jemanden mögen oder nicht, für schüchtern oder überheblich, intelligent oder dumm halten – alle möglichen Gefühle beeinflussen unsere Interpretation dessen, was jemand in seinem*ihrem Verhalten aussagt.
Eine Lehrerin, die eine Schülerin für grundsätzlich engagiert und intelligent hält, wird eine Frage wie „Könnten Sie das bitte erklären? Ich verstehe nicht, was Sie gerade gesagt haben.“ vermutlich als Wissensdurst und Lernbereitschaft auffassen. Einer anderen Schülerin, die als faul und unruhig gilt, wird womöglich bei der gleichen Frage Desinteresse und mangelndes Lernvermögen unterstellt werden.
Diese Bestimmung des „Inhalts“ einer Äußerung oder eines Verhaltens auf der Basis der Beziehung gilt grundsätzlich in jedem Bereich der Kommunikation, in der wissenschaftlichen und beruflichen Welt und auch im Alltag. Wir können uns nicht nicht beziehen. Beziehung ist Kommunikation, weil wir einander nicht wahrnehmen können, ohne uns aufeinander zu beziehen.
Auf den Punkt gebracht
1 Verhalten ist Kommunikation. Kommunikation ist etwas, das passiert, wenn Menschen einander wahrnehmen.
2 Alle Menschen kommunizieren.
3 Kommunikation ist nicht immer gewollt oder beabsichtigt.
4 Verhalten wird immer interpretiert. Diese Interpretation erfolgt unbewusst oder bewusst.
5 Es gibt kein objektives Verstehen. Alles wird von einem bestimmten Standpunkt aus verstanden.
6 Wir können nicht verstehen, ohne zu interpretieren. Auch Missverstehen ist eine Interpretation.
7 Die Beziehung bestimmt die Interpretation des Inhalts.
Zum Weiterdenken und Vertiefen
1 Sie sehen eine Person auf der Straße, die Sie nicht sehr sympathisch finden, begrüßen sie aber dennoch aus Höflichkeit. Die Person reagiert nicht und geht einfach weiter, ohne zu grüßen. Was empfinden Sie? Wie ordnen Sie ihr Verhalten sein?
2 Das Gleiche passiert ein paar Tage später mit einem*r Freund*in. Sie grüßen, aber es kommt nichts zurück. Was empfinden Sie diesmal? Wie verstehen Sie das Verhalten Ihres*r Freund*in?
2 Kommunikationssituationen und ihre Dimensionen
Wenn wir kommunizieren, tun wir das immer in einer bestimmten Situation. Die Situation hat Einfluss darauf, wie wir kommunizieren, also wie wir unser Verhalten auf andere beziehen. Wir treffen – bewusst oder unbewusst – Entscheidungen darüber, was wir ausdrücken möchten, welche Details wir erwähnen oder auslassen, welche Informationen wir zusätzlich für das Verstehen mitliefern und wie wir diese Informationen darstellen. Um diese Entscheidungen treffen zu können, müssen wir verschiedene Dimensionen der jeweiligen Kommunikationssituation berücksichtigen. Dazu gehören einerseits Rahmenbedingungen wie zeitliche, räumliche und soziale Nähe und Distanz, andererseits aber auch Vorstellungen über das Vorwissen der Kommunikationspartner*innen (der Adressat*innen), potentielle Erwartungen, die auf früheren Erfahrungen beruhen, und unterschiedliche Absichten (Intentionen) bei der Kommunikation.
In sogenannten Face-to-Face-Kommunikationssituationen sind alle Beteiligten gleichzeitig anwesend – wie zum Beispiel die Frauen auf dem Foto am Beginn dieses Kapitels (Abbildung 9). Stellen Sie sich vor, dass aus dieser Situation heraus eine der Frauen etwas kommentiert, das auch die anderen im Blickfeld haben: Sie schaut vielleicht auf ein Geschäftslokal, das kürzlich eröffnet worden ist, und macht eine Bemerkung dazu. Den anderen braucht sie es nicht eigens zu beschreiben, sie können es auch selbst sehen. Die Frauen können auf eine gemeinsame Wahrnehmung zurückgreifen. Möglicherweise entwickelt sich das Gespräch dann aber noch in eine andere Richtung und eine der Frauen nimmt auf etwas anderes Bezug, eine Begegnung vom Vortag vielleicht. In diesem Fall muss sie schon mehr erklären und beschreiben, den anderen eine Situation schildern und nachvollziehbar machen, in der sie nicht dabei waren. Geht es dabei um gemeinsame Bekannte oder ein gemeinsames Lebensumfeld, kann die Erzählerin sich aber immer noch auf viel geteiltes Wissen beziehen. Außerdem muss in der Face-to-Face-Kommunikation nicht alles verbalisiert (versprachlicht) werden, was ausgedrückt werden soll, sondern es können auch – bewusst oder unbewusst – nonverbale Elemente der Kommunikation eingesetzt werden, wie Mimik, Gestik oder bestimmte Körperhaltungen.
Wenn nun eine entfernte Bekannte anruft, die wissen möchte, was es Neues gibt, müsste die Erzählerin entscheiden, was sie berichtenswert findet und wie sie es für ihre Gesprächspartnerin darstellt. Dabei würde sie wahrscheinlich darauf Rücksicht nehmen, dass die entfernte Bekannte nicht über dieselben Informationen verfügt wie die Anwesenden. Und wenn nicht gerade Videotelefonie eingesetzt wird, ändert sich die Situation auch dadurch, dass die Gesprächspartnerinnen einander nur hören, aber nicht sehen können.
Die geschilderten Kommunikationssituationen unterscheiden sich in ihren Rahmenbedingungen: in ihrem Verhältnis von Nähe und Distanz, zeitlichen und räumlichen Verhältnissen. In