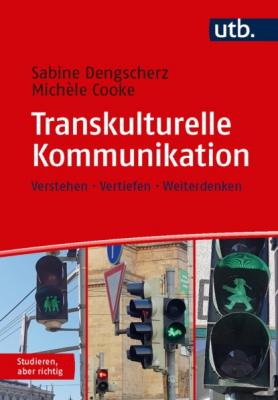Transkulturelle Kommunikation. Michèle Kaiser-Cooke
Читать онлайн.| Название | Transkulturelle Kommunikation |
|---|---|
| Автор произведения | Michèle Kaiser-Cooke |
| Жанр | Социология |
| Серия | Studieren, aber richtig |
| Издательство | Социология |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783846353196 |
Wie wir am Beispiel des Hasen gesehen haben, umfasst die Kommunikation nicht nur Sprache, sondern vieles mehr: Alles, worüber und womit Menschen sich verständigen, ist Gegenstand der Kommunikation oder kann es werden. Unser „Stoff“ ist also potentiell die ganze Welt. Oder schlichtweg: das ganze Leben.
Auch ein anscheinend banaler Alltagsgegenstand wie ein Fenster ist im Kontext der Transkulturellen Kommunikation alles andere als selbstverständlich. Was ist die Funktion eines Fensters? Auch hier lautet die Antwort: Es kommt darauf an.
Es kommt zum Beispiel darauf an, ob wir von einem „westlichen“ Fenster oder von einem Fenster in der Tradition der islamischen Architektur sprechen. In der sogenannten „westlichen“ Tradition dient ein Fenster zwar dazu, Licht in einen Raum zu lassen, es wurde aber im Laufe der Jahrhunderte auch immer mehr als Möglichkeit verstanden, hinauszuschauen und gesehen zu werden oder das „Außen“ nach innen zu bringen (siehe Abbildungen 4, 5 und 6).
Fenster (Foto: pixabay)
Fenster (Foto: pixabay)
Fenster (Foto: pixabay)
Das „islamische“ Fenster hingegen soll das Licht so in den Raum filtern, dass es gemäß den ästhetischen Ansprüchen des Korans wirkt. Das Fenster soll nicht in erster Linie nach außen wirken, sondern den Blick nach innen lenken (siehe Abbildungen 7 und 8).
Sprechen wir dann vom „gleichen“ Gegenstand? Ja. Und nein. Je nach Tradition, nach Kultur und schließlich nach unserer Perspektive verstehen wir ein Fenster als etwas anderes.
Es kann also wirklich alles Gegenstand unseres Fachs werden. Das ist die große Herausforderung – und gleichzeitig die große Faszination.
Fenster (Foto: „Painted Mosque“ von Jocelyn
Erskine-Kellie, flickr.com, CC-BY 2.0)
Fenster (Foto: pixabay)
Wir lernen nie aus, weil sich die Welt ständig ändert. Etwas, das uns heute unwichtig erscheint, kann morgen oder für eine andere Person, für Menschen in einem anderen Land oder in einer anderen sozialen Gruppe von großer Bedeutung sein. Kann heiß umstritten werden, wie zum Beispiel das Bienensterben, der Klimawandel oder das Verbot von Kopftüchern in säkularen Schulen. Oder kann auch gefeiert (und gleichzeitig umstritten!) werden, wie der Weltfrauentag. Kann eine großartige Entdeckung darstellen oder eine gefährliche Bedrohung. Die Menschen werden darüber reden wollen, davon schreiben, miteinander diskutieren und verstehen wollen, wie denn „die anderen“ das sehen.
Und wir, wenn wir gelernt haben, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, können sie dabei unterstützen.
Bei allem technologischen Fortschritt werden Menschen nie aufhören, miteinander zu kommunizieren. Der „Stoff“ der Transkulturellen Kommunikation ist nie erschöpft. Und damit bleibt auch der Bedarf an Kommunikationsexpert*innen immer gegeben: Menschen, die gelernt haben, die Kommunikation zwischen Menschen und Kulturen zu fördern. Wir leben zwar in einer „globalisierten“ Welt, in der viele Unterschiede geglättet oder kleiner werden. Es entstehen aber gleichzeitig neue Unterschiede, neue Sichtweisen und neue Perspektiven, die neue Verständnishürden errichten und alte untermauern. Auch im sogenannten „globalen Dorf“ entstehen immer neue Möglichkeiten, einander zu verstehen und misszuverstehen. Auch das Englisch, das so viele sprechen, ist alles andere als „global“; es ist vielmehr ein Ausdrucksmittel für lokale Interessen und kulturell bedingte Anliegen. Englisch ist nicht mehr nur „englisch“, sondern die Sprache vieler Kulturen mit ebenso vielen Dimensionen und Bedeutungen. Im transkulturellen Rahmen dieser angeblichen Lingua franca sprechen nicht alle die gleiche Sprache. Auch hier ist gegenseitiges Verstehen nicht selbstverständlich.
Auf Transkulturelle Kommunikation können wir nicht verzichten. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Kommunikationsprozessen hilft uns, sie besser zu verstehen und bewusst mit ihnen umzugehen.
Hinweis zu genderbewusster Sprache
Wie wir in diesem Buch noch ausführlicher diskutieren werden, ist (unsere) Sprache – das, was wir sagen und ausdrücken – nie neutral. Alles, was wir sagen, könnte auch auf unzählige andere Arten gesagt werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir etwas sagen (wollen), um zu einer bewussten Entscheidung zu finden, die am besten ausdrückt, wie wir die Welt sehen.
Eine dieser bewussten Entscheidungen für dieses Buch ist, dass wir bei genderspezifischen Bezeichnungen für Personen eine Mischform aus grammatisch männlichen und grammatisch weiblichen Formen verwenden und einen Asterisken (*) hinzufügen – „Übersetzer*innen“, „ein*e beste*r Freund*in“, „jede*r von uns“ – wobei in manchen Fällen eine grammatisch männliche Endung wegfällt (zum Beispiel in „das Verhalten Ihres*r Freund*in“).
Wir haben uns für diese Variante – und damit bewusst gegen andere Formen wie zum Beispiel die rein maskuline Form („Übersetzer, jeder“) oder Formen mit Binnen- bzw. End-Majuskeln („ÜbersetzerInnen, jedeR“) vor allem aus den folgenden zwei Gründen entschieden:
Zum einen wollen wir damit Raum schaffen – orthografisch, sprachlich und (somit auch) gedanklich – für Geschlechtsidentitäten, die nicht in die starre/erstarrte Dichotomie Mann-Frau passen. Wir sehen den Asterisken als Anerkennung, Einladung und Versuch der Sichtbarmachung von Menschen, die sich nicht (nur) als „Mann“ bzw. „Frau“ identifizieren bzw. identifizieren können oder/und wollen – darunter intergeschlechtliche Personen, Transgender-Personen, Personen mit nichtbinärer Geschlechteridentität, genderqueere Personen und andere. Die Inhalte, die wir in diesem Buch besprechen, betreffen alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.
Zum anderen wollen wir damit auf die diskursive – das heißt, sprachliche und soziale – Konstruiertheit von allen solchen Bezeichnungen generell hinweisen. Menschengruppen wie „Frauen“, „Männer“, „Übersetzerinnen“, „Deutsche“, „Europäer*innen“ etc. sind nicht „einfach so“ in der Welt „natürlich“ vorhanden. Stattdessen werden sie immer wieder aufs Neue als Gruppe konstruiert und gefestigt, unter anderem auch durch die automatisierte Verwendung ihrer Bezeichnungen. (Mehr zum Begriff Diskurs und seinen Wechselwirkungen mit Gesellschaft und Macht werden wir in den folgenden Kapiteln besprechen.) Der Asterisk soll also auch als Erinnerung daran dienen, dass unsere Sprache Realität schafft, diese aber nie die einzig mögliche oder einzig gültige Art ist, die Welt zu verstehen. Dies gilt nicht nur in der Transkulturellen Kommunikation, sondern in jeder Form der Sprachverwendung.
Quellennachweis
BELTING, Hans (2008): Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks. München: C. H. Beck.
I Kommunikation
1 Was ist Kommunikation?
Frauen