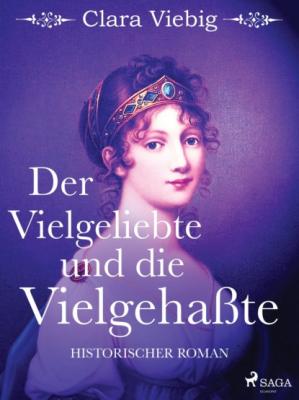Der Vielgeliebte und die Vielgehaßte. Clara Viebig
Читать онлайн.| Название | Der Vielgeliebte und die Vielgehaßte |
|---|---|
| Автор произведения | Clara Viebig |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9788711466834 |
Und doch gleitet der Blick des alten Königs suchend umher. Kein Mensch zu sehen. Heimlich hat er die Vigne verlassen, er liebt Begleitung nicht, wenn er zu Wilhelminens Gedächtnistempel geht; sie war die einzige gewesen, die an ihm hing – wer sonst noch? Condé vielleicht. Ob er ihn reiten kann, wenn er morgen die Revue auf dem Tempelhofer Feld abhält? Bis vors Berliner Tor muß er wohl fahren – die verdammte Gicht, wenig königlich – aber dann zu Pferde, die Zähne zusammenbeißen! Er kann sich unmöglich vor den französischen und englischen Offizieren, die hergeschickt worden sind, die Eliteregimenter der besten Armee der Welt zu sehen, als alter lahmer Mann zeigen. Sie müssen zu Hause berichten, daß mit diesem König von Preußen, der zwar nicht viele Zähne mehr hat, aber trotzdem noch tüchtig beißen kann, jederzeit zu rechnen ist. Und Condé ging ja sanft – Condé, dieser Schelm, dieser Filou! Ein weicherer Ausdruck kommt in das strenge Gesicht. Hat der doch gestern, als er vergessen hatte, ihn mit der gewohnten Melonenschnitte zu belohnen, sich die selber geholt, war ins Schloß nachgetrabt, hatte im Parolesaal ein paar Fliesen zertreten und war plötzlich im Speisesaal erschienen, wo man grade zur Tafel saß. War mit Scharren und Wiehern dicht an den Tisch gekommen – ha ha, was hatte der Abgesandte des Sultans für entsetzte Augen gemacht! Der König lacht laut auf. In der Tasche hatte Condé ihm feucht geschnobert. Erst nachdem er von der Fruchtschale auf der Tafel seine Melonenschnitte bekommen und ein paar Feigen, war er wieder abgetrabt. Die ganze Tafelrunde hatte gelacht, die aufwartenden Lakaien hatten gelacht: der König lacht, da durften sie alle lachen. Selbst der Türke hatte sich ein Lachen aufgezwängt.
Ja, Condé liebte ihn. Und Alcmène liebte ihn, und Pax und Tisbe, Superbe und die kleine weiße Biche – nur Hunde, aber Hunde sind treuer als die Menschen und mehr wert. Wenn er starb, sollte man ihn begraben dicht bei ihren Grabsteinen im Garten seiner Vigne. Der König nickt vor sich hin: das würde er schriftlich machen. Aber dann wird sein erheitertes Gesicht wieder sehr ernst: er darf ja noch nicht sterben. Noch immer heißt es, mit Standhaftigkeit gegen das allgemeine Schicksal – den Tod – ankämpfen. Erst muß das mit dem Fürstenbund in Ordnung sein. Für Preußen zu wichtig, eine wertvolle Stütze für den schwachen Nachfolger! Es durchschauert den Grübelnden plötzlich wie bange Ahnung: der Thronfolger würde doch niemals daran denken, den Fürstenbund wieder aufzulösen? Dieses Bündnis zur Unterstützung Preußens durch die kleineren Staaten war ebenso wichtig wie jenes Bündnis gegenseitiger Waffenhilfe, das er schon vor Jahren mit Katharina von Rußland geschlossen hatte. Ach, wenn der, der Friedrich dem Großen folgte, nur kein kleiner Friedrich Wilhelm wäre! Ein tiefer Mißmut gräbt noch neue Falten in die gedankenschwere Stirn: wie der Vater so der Sohn. Wenn sein Bruder, Prinz August Wilhelm, nach der Schlacht von Kolin nicht so unsicher zögernd den Befehl zum Rückzug der Armee gegeben hätte, alle vorherigen Erfolge durch seine unglückselige Entschlossenheit zunichte machend, so wäre viel Blut erspart worden.
Ach, dieser siebenjährige Krieg! Trotz alledem, was er durch ihn erreicht hatte, war der für Preußens Zukunft ein Menetekel. War diese herrliche, gut einexerzierte Armee Preußens überhaupt zu ersetzen? Ah, eine neue Armee schaffen, sie der alten dahingeopferten gleichwertig machen! Noch war die neue es nicht. Wenn nur dieser alte verbrauchte Körper nicht wäre, dann könnte es vielleicht doch noch gelingen, hatte er, der Alte, doch noch mehr Energie, als der Nachfolger besaß. Oh, dieser Prinz von Preußen! Der König hätte gern den Krückstock gehoben – er war zornig, wie er seit Jahren schon zornig war –, aber der Stock lag zu seinen Füßen im Laub, und er konnte sich nicht mehr so tief bücken.
Dem König ist es heiß geworden, gleich darauf ist es ihm kalt, ein Wind bläst ihn an. Ach, es lohnt nicht, es lohnt nicht mehr, wozu sich noch einmal aufregen? Denn trägt der Mensch nicht schon bei seiner Geburt den einen, nicht auszumerzenden, bestimmten Charakter in sich? Erziehung kann vielleicht den Menschen seine Fehler erkennen lehren, aber nie wird sie seine eigentliche Natur ändern. Die Grundlage bleibt, jeder trägt den Urstoff seiner Handlungen in sich.
Langsam ist des Königs Erregung abgeblaßt: Sein Preußen altert, wie er selber gealtert ist, das ist nun einmal der Schicksalsweg von allem. Ebenso auch, daß ein Alternder von seinen Dienern bestohlen wird, von seinen Ministern belogen und daß der Nachfolger auf seinen Tod wartet. Philosophie ist eine große Trösterin. Und sie lehrt mit Anstand sterben.
«Mais je m’occuperai des affaires de l’état jusqu’au terme, et je mourrai en travaillant», sagt der König jetzt ganz laut und hebt die gesenkte Stirn. In seine müden, wie in weite Fernen verlorenen Blicke ist ein Aufblitzen gekommen: Ich bin noch immer hier – da schreckt ihn ein Rascheln im Seitenweg. Aha, sie haben ihn vermißt im Schloß, haben den Kammerdiener nach ihm ausgeschickt! Er kichert in sich hinein: Sein dicker Fredersdorff wird schön pusten: – ‹Majestät, wo stekken denn Majestät?!› – doch ausgerückt, dem Fredersdorff einen Possen gespielt! Aber doch gut, daß der jetzt kommt. Der König fühlt sich plötzlich müde: zu lange gestanden, kalte Füße bekommen.
Aber es ist nicht Fredersdorffs Tritt, der sich rasch nähert: leichte elastische Schritte, um die Säulen des Tempels biegt eine Frauengestalt, noch sommerlich gekleidet. Mittagslicht fällt auf ein helles Kleid, auf ein helles Gesicht.
Ein Frauenzimmer?! Des Königs Augen blicken durchbohrend: «Demoiselle, was tut Sie hier in meinem Park? Sie hat hier nichts zu suchen.»
Die Frauensperson versinkt in einer tiefen Verneigung, ihre Röcke rauschen; sie ist nach der Mode gekleidet, aber das Haar nicht gepudert, schön gedrehte seidige Locken fallen mit Goldschimmer auf einen sehr weißen Hals. Die Verneigung scheint demutsvoll, aber der Blick ist erhoben, sieht dem König frei ins Gesicht. Eine klangvolle Stimme – der König liebt Musik, diese Stimme hat etwas vom Cello – «Majestät, halten zu Gnaden, seit lange schon harre ich jener Gunst des Augenblicks, die es mir vergönnt, Euer Majestät zu begegnen. Lesen Euer Majestät allergnädigst, lesen!» Sie hält ihm ein Papier hin und versinkt dabei wieder in einer Verneigung, aber ihr Blick, klug, kühn, glänzend von Begehren, forscht in des Königs Gesicht.
Dreistigkeit, Frechheit, ihn bei seinem Spaziergang im Park so anzufallen! Weiß das Mensch denn nicht, daß in seiner Vigne und ihrem Garten Weibsbildern der Zutritt verboten ist? Der Stock, der Stock, wenn er den jetzt hätte!
Als ob sie’s erriete, bückt sie sich rasch, trotz des Reifrocks geschmeidig – schon hält er seinen Stock wieder in Händen. Aber er hebt ihn nicht drohend, Kühnheit ist immer einige Rücksicht wert. «Was soll mir Ihr Wisch? Ich lese keine Bittschreiben hier. Stell Sie sich hinten an, wenn heute nach der Tafel die Bauern aus der Neumark bei mir vorstellig werden.»
«Majestät halten zu Gnaden, aber Frauen ist der Zutritt ins Schloß verboten. Euer Majestät höchsteigener Befehl. Man würde mich schon vor der Türe abweisen.»
Aha, sie erinnerte ihn an seinen eigenen Befehl! Keck, aber sie hatte sich gut gemerkt, was er befohlen. Er sieht sie scharf an, sie hält ruhig seinen Blick aus, in ihren Augen schimmert ein feuchter Glanz.
Ein leichtes Vibrieren von Erregung ist in der Frauenstimme: «Halten zu Gnaden, Majestät, mein Anliegen hat auch nichts mit dem der Bauern gemein.» Sie tritt noch einen Schritt näher, die Bittschrift flattert wie eine weiße Taube ihm dicht vorm Gesicht.
«Rücke Sie mir nicht so nah auf den Leib! Nehme Sie Ihren Wisch weg!» Es klingt ärgerlich, unsanft stößt er mit dem Stocke auf: «So sage Sie schon, was Sie will!»
Alle rosige Farbe ist aus den schönen Wangen gewichen, aber es klingt unerschrocken: «Ich erbitte die Gnade des großen Königs für meinen und Hochdero Neffen, des Prinzen von Preußen, Sohn!» Sie sinkt in die Knie.
Er mißt sie mit seinem großen Blick: Schönheit ist sonst meist mit Dummheit gepaart, die hier ist nicht dumm. Und ein entschlossenes Gesicht. «Einen Sohn hat Sie