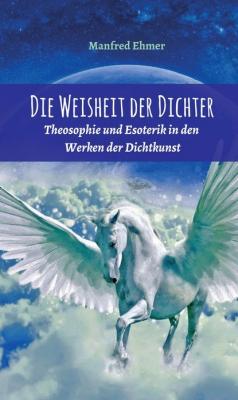Die Weisheit der Dichter. Manfred Ehmer
Читать онлайн.| Название | Die Weisheit der Dichter |
|---|---|
| Автор произведения | Manfred Ehmer |
| Жанр | Религия: прочее |
| Серия | Edition Theophanie |
| Издательство | Религия: прочее |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783347008762 |
Da brachte es durch Glutes Kraft sich selbst hervor.
Da ward das Eine gleich von Liebeskraft durchwallt,
Die, aus dem Geist geboren, aller Dinge Same ist:
Das Herz erforschend, taten es die Weisen kund,
Wie alles Sein im Nichtsein seine Wurzel hat.
Und als die Denker querdurch spannten eine Schnur,
Da gab es 'Oben' plötzlich, und ein 'Unten' auch;
Und keimesmächt'ge Kräfte traten auf den Plan:
Begehren unten, oben der Gewährung Kraft.
Wer hat es ausgeforscht, und weiß es, tut es kund,
Woher die Schöpfung kam, und wie die Welt entstand?
Die Götter traten nach dem Einen erst ins Sein.
Wer also weiß, woher sie ausgegangen sind?
Woher die Schöpfung ist, und ob der Eine sie gemacht,
Das weiß, der über diese Welt die Oberaufsicht hat,
Und aus dem höchsten Himmel auf sie niederblickt:
Der weiß es wohl? Vielleicht weiß er es selber nicht.15
Wie ein Monument steht das Urgestein der altindischen Dichtung im Strom der Zeiten, alle Wechsel und Wandlungen überdauernd, einmalig in der Wucht und Größe seiner mystischen Schau, unvergleichlich im Zauber seiner lyrischen Poesie. Als Verfasser der Veden wird uns ein gewisser Vyasa genannt – ein hoher Eingeweihter zweifellos, eine bis heute nicht als historisch nachgewiesene Person, vom Dämmerlicht einer längst vergangenen Frühzeit umhüllt. Überdies scheint es fraglich, ob die Veden in ihrer Gesamtheit, mit ihrer großen Spannweite und der Vielfalt an Entwicklungsstufen, überhaupt der Feder eines einzelnen Mannes entsprungen sein können; so könnte man „Vyasa“ auch als einen Gattungs- oder Gruppennamen sehen, der auf eine ganze Schar von dichtenden Sehern der vedischen Zeit angewandt wurde, ähnlich wie im alten Griechenland Namen wie „Orpheus“ oder „Homer“ sich nicht so sehr auf einzelne Persönlichkeiten, sondern auf ganze Generationen von Dichter-Sehern beziehen können. Wie man eine ganze Literaturgattung „homerisch“ nennt, so schreibt man die altindische Dichtung als Ganzes „Vyasa“ zu.
Die indische Überlieferung kennt außer den Veden, die als übermenschlichen Ursprungs gelten, noch eine Gattung von Literatur, die auf die Autorität heiliger Menschen zurückgeht. Dazu zählen vor allem die beiden großen Epen Indiens – das Ramayana und das Mahabharata, ferner gehören hierher die Puranas, d. h. alte Erzählungen, die Legenden vermischt mit kultischen Vorschriften und religiösen Betrachtungen beinhalten. Als Verfasser des Mahabharata wird ebenfalls Vyasa genannt – auch hier wieder eine mythische Figur, da das Dichtwerk in seiner heutigen Form eine im Laufe eines Jahrtausends angewachsene Sammlung darstellt. Das Ramayana, das von dem Heiligen Valmiki verfasst sein soll (im 2. Jhrt. v. Chr.), behandelt die Sage von dem göttlichen Helden Rama, dem ein Riesenkönig seine schöne Frau Sita raubte, von seinen Fahrten und Kämpfen, um sie wiederzugewinnen, und von seinem schließlichen Sieg. Wenn die Inder das Ramayana das erste Kunstgedicht nennen, so sicher mit Recht; denn dort wird zum ersten Mal von jenen Schmuckmitteln reichhaltig Gebrauch gemacht – etwa Vergleichen, poetischen Figuren und Wortspielen –, die in der späteren indischen Poetik eine so hervorragende Bedeutung gewinnen.
Die Upanishaden –
Perlen religiöser Poesie
Einer späteren Bewusstseins-Entwicklungsstufe als die altvedischen Dichtungen gehören die aus der klassischen Zeit stammenden Upanishaden an. Mit dem Beginn der Upanishaden-Literatur setzt, gegenüber der älteren mythischen Bewusstseins-Struktur,
eine wahre Explosion des mentalen Denkens ein. Dieser Durchbruch war notwendig; denn das Denken (Sanskr. Manas) gehört nun einmal entscheidend zur Wesenskonstitution des Menschen und musste darum evolutionär herausgebildet werden. Indien, nicht Europa, war hierbei der Vorreiter. „Wenn der Mensch einen Gedanken in seinem Geist hervorbringt, dann geht dieser in seinen Odem, aus dem Odem in den Wind, und der Wind gibt ihn an die Götter weiter“ heißt es in einem heiligen Text. Ein schönes Lied über das menschliche Denken, die Kraft des Manas, ist später unter dem Namen Shiva-Sankalpa-Upanishad unter die philosophischen Texte der Veden aufgenommen worden:
Das Göttliche, das in die Ferne wandert
Und immer wieder doch zurückkehr'n muss,
Von allen Lichtern ist es einzig wahres Licht:
Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!
Durch das die Weisen, heil'ger Werke kundig,
Vollziehn die Riten und den Opferguss,
Das als Geheimnis in den Menschen waltet:
Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!
Das als Erkennen, Wille und Bewusstsein
Im Innern strahlt, von Licht ein Überfluss,
Und ohne das kein Werk ist zu vollbringen,
Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!
Das, selbst unsterblich, alle die drei Zeiten
In sich umfasst, vom Anfang bis zum Schluss,
Durch das das Opfer flammt der sieben Priester:
Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!
In dem die Verse festsitzen wie Speichen
In einer Nabe sicherem Verschluss,
In dem die Einsicht aller Wesen wurzelt,
Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!
Das, wie ein Wagenlenker seine Rosse,
Die Menschen lenkt nach einsicht’gem Beschluss,,
Das fest im Herzen steht und doch umhereilt:
Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!16
„Das Denken führe mich zu glücklichem Entschluss!“ heißt es hier immer wieder, ein wahrer Hymnus an das Manas-Prinzip des Denkens! Gegenüber der reinen Regelbefolgung einer eher exoterischen, kultisch-rituell ausgerichteten Religion, wie der alte Vedismus zweifellos eine war, findet in diesen Strophen erstmals eine Emanzipation des philosophischen Denkens statt, ein Übergang vom Mythos zum Logos, wie wir ihn im Abendland erst mit dem Auftreten der ionischen Naturphilosophen um 500 v. Chr. in vergleichbarer Form erleben.
Die Upanishaden sind die ältesten Zeugnisse philosophischen Denkens innerhalb der uns bekannten Menschheits-Geschichte! Da sie aber auf verschiedene Schulen und Denker zurückgehen, lehren sie kein festumrissenes System, sondern bringen die mannigfaltigsten Ansichten zum Ausdruck; neben einem ausgeprägt naturmagischen Denken tritt eine tiefsinnige Mystik hervor, die auf spätere Entwicklungen maßgeblichen Einfluss ausübt. Die Grundanschauungen dieser Upanishaden-Gottesmystik stehen fest. Man könnte sie etwa so zusammenfassen: Die Einzelseele ist ihrem Wesen nach ewig und unsterblich; durch das Gesetz der karmischen Tatfolge gezwungen, irrt sie umher, in den vergänglichen Körpern von Pflanzen, Tieren, Menschen und Göttern gebannt, und kommt dabei innerlich doch nicht zur Ruhe. Einen Ausweg aus dem Kreislauf der Existenzen bietet nur die Erkenntnis, dass das Vergängliche der Seele in Wahrheit nicht angehört – dass die Seele vielmehr mit dem ewigen, seligen Weltgeiste nicht nur verwandt, sondern wesenseins ist. Wer diese höchste Wahrheit erfasst, ist über den Wechselfluss von Leben und Tod hinausgehoben: er wird nicht mehr wiedergeboren, sondern geht in das Absolut-Göttliche, in das Brahman ein.
Das altindische Verb upa-ni-shad bedeutet „sich nahe bei (upa) jemanden nieder (ni) setzen (sad)“, und das heißt so viel wie „sich verehrungsvoll jemandem nähern“, sich als Schüler und einzuweihender Adept zu Füßen eines Meisters zu setzen. Die Upanishaden sind daher durchweg Einweihungs-Literatur, Verehrungs-Literatur, Meistergespräche, die