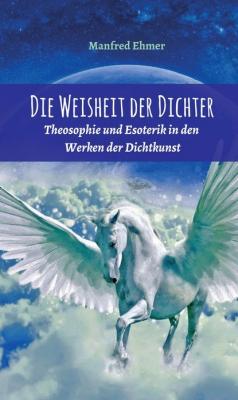Die Weisheit der Dichter. Manfred Ehmer
Читать онлайн.| Название | Die Weisheit der Dichter |
|---|---|
| Автор произведения | Manfred Ehmer |
| Жанр | Религия: прочее |
| Серия | Edition Theophanie |
| Издательство | Религия: прочее |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783347008762 |
Die Veden – Urgestein
altindischer Dichtung
Wie aus dem wohlentflammten Feuer die Funken,
Ihm gleichen Wesens, tausendfach entspringen,
So geh’n, o Teurer, aus dem Unvergänglichen
Die mannigfachen Wesen hervor
Und wieder in dasselbe ein.
Mundaka-Upanishad 2,1
Dichterkraft und Sehertum, Sprachgewalt und mystische Schau – nirgendwo liegen sie so dicht beieinander wie in der altindischen Literatur, die in den ältesten Texten der Menschheit, den Vedas, den Puranas und Brahmanas, erstmals Ausdruck gewann, um wie ein Echo in den heiligen Schriften des klassischen Indien nachzuhallen. Die altindische Dichtung, eine reine Götterhymnendichtung noch, Ausdruck einer erhabenen Menschheits-Kindheit, ist dem Wurzelboden einer frühindogermanisch-arischen Spiritualität erwachsen, die wie eine Urgesteins-Schicht allem später Dazugekommenen zugrunde liegt. Ihrem Ursprung wie ihrer geistigen Grundhaltung nach beruht die altindische Dichtung weder auf der rein magischen Vorstellungswelt der Naturvölker noch auf den eher weltflüchtigen Tendenzen der späteren Hochreligionen, sondern auf jener geistig hochstehenden, natur- und kosmosverbundenen Spiritualität, die in der Frühzeit des indischen Ariertums Gestalt annahm. Heute indes können wir uns dieses geistige Urwissen wieder neu aneignen.
Aus dem geistigen Urgestein der frühindisch-arischen Spiritualität ragen wie vier monolithische Felsblöcke die vier Haupt-Veden hervor, die mit den zeitlich jüngeren Upanishads heute noch zu den kanonischen Texten des Hinduismus zählen. Das Wort Veda leitet sich her von vidya, das Wissen, das Gesehene. Darin finden wir die indogermanische Wurzel vid, die uns auch in dem lateinischen Verb videre für sehen begegnet. Die Veden, deren Umfang den der Bibel um das Sechsfache übersteigt, verstehen sich somit als geheiligtes Wissen. Nach orthodoxer Ansicht sind sie nicht menschliches, sondern göttliches Wissen, das anfanglos und unvergänglich ist, und das von den Priestern der Vorzeit in geheiligter Schau „gesehen“ wurde. Vedisches Wissen ist also Seherwissen.
Grundlegend für das vedische Weltbild ist, wie auch Hans Joachim Störig in seiner Weltgeschichte der Philosophie schreibt, dass „die unserem Denken heute so selbstverständliche Unterscheidung von Belebtem und Unbelebtem, von Personen und Sachen, von Geistigem und Stofflichen noch nicht vorgenommen wurde. Die frühesten Götter waren Kräfte und Elemente der Natur. Himmel, Erde, Feuer, Licht, Wind, Wasser werden, ganz ähnlich wie bei anderen Völkern, als Personen gedacht, die nach Art der Menschen leben, sprechen, handeln und Schicksale erleiden.“11
Der gesamte Veda enthält vier Sanhitas, Sammlungen von Liedern und Sprüchen für den Gebrauch der Priester bei feierlichen Opferhandlungen – den Rig-Veda, den Sama-Veda, den Yajur Veda und den Atharva Veda. Der Rig-Veda zunächst ist das Buch der Götterhymnen. Seine 1028 Hymnen richten sich an die verschiedenen Naturgötter des frühindisch-arischen Pantheons: an den Feuergott Agni etwa, an den Sonnengott Surya, an den Windgott Vata, und natürlich an Indra, den Beherrscher von Blitz und Donner. Der Sama-Veda enthält Lieder und ist daher von grundlegender Bedeutung für die indische Musik. Der Yajur-Veda ist eine Sammlung von Opfersprüchen. Der Atharva-Veda mit seinen 731 Hymnen gilt als eine Sammlung von Zaubersprüchen und magischen Anrufungen; aber es sind, wie im Rig-Veda, auch Lieder zum Lobpreis von Göttern darin zu finden.
Wir haben guten Grund, den Atharva Veda gerade seiner Magie wegen zu den ältesten Teilen der Veden-Sammlung zu rechnen; heiliges Mysterienwissen erklingt aus diesen in Birkenrinde eingeritzten Hymnenliedern, die mindestens schon um 1800 v. Chr., wenn nicht gar noch früher, entstanden sein müssen. Ist doch die Magie die Urform der Religion, der Magier stets der Vorläufer des Priesters gewesen. Tatsächlich mag das Alter des Atharva-Veda gut 4000 Jahre betragen; seine Texte stammen vermutlich noch aus der Zeit, da die ostindogermanischen Stämme der Aryas, wie sie sich selber nannten – „Arier“, das heißt die „Edlen“–, in das damals noch dichtbewaldete Industal und in den Pandschab vorstießen. Der Geist jener Zeit war geprägt von einer staunenden Ehrfurcht vor der Natur. Die voralpine Landschaft an den Ufern des Indus und die schneebedeckten Berge des Himalaya im Hintergrund – das war die Umgebung, in der jene ersten „Arier“, ein schlichtes anspruchsloses Bauernvolk, das Göttlich-Numinose in der Natur erleben konnten.
Die Zeit zwischen 1000 und 750 v. Chr., gekennzeichnet durch das weitere Vordringen der Arier in die Ganges-Ebene, gilt nicht als die altvedische oder Hymnen-Zeit, sondern als die Zeit der Opfermystik. Die Kaste der Brahmanen hatte sich allmählich herausgebildet. Und der Mensch hatte sich gegenüber der Natur und den Göttern ein neues Selbstbewusstsein angemaßt: der Opfernde ist nun nicht mehr der Bittende, der sich an höhere Weltwesen wendet, sondern er ist der machtvolle Magier, der durch zwingenden Opferspruch den Göttern alles dem Menschen Zuträgliche abnötigt. Fast sieht es so aus, als stünden nicht die Götter über den Menschen, sondern umgekehrt die Menschen über den Göttern. In der Zeit zwischen 750 und 500 v. Chr., als die Arier die Urbevölkerung des zentralindischen Dekkan-Hochlandes unterwerfen, entsteht die neue Literaturgattung der Upanishaden: das Indertum hatte sich ganz auf das Gebiet der philosophischen Spekulation geworfen, wobei der alte vedische Götterglaube nur noch schemenhaft weiterlebte.
Die Poesie des Rig-Veda ist eine bereits hochentwickelte Kunstdichtung mit stark höfischem Grundzug; die Lieder sind von priesterlichen Sängern im Dienste von Fürsten geschaffen worden, die ihnen ihre Werke mit reichen Gaben – Rindern und Rossen, Gold und Edelsteinen – belohnten. Als ein Beispiel für die zutiefst naturnahe Götterlyrik der vedischen Zeit sei hier der Hymnus an die Göttin der Morgenröte wiedergegeben.
In Majestät aufstrahlt die Morgenröte,
Weißglänzend wie der Wasser Silberwogen.
Sie macht die Pfade schön und leicht zu wandeln
Und ist so mild und gut und reich an Gaben.
Ja, du bist gut, du leuchtest weit, zum Himmel
Sind deines Lichtes Strahlen aufgeflogen.
Du schmückest dich und prangst mit deinem Busen
Und strahlst voll Hoheit, Göttin Morgenröte.
Es führt dich ein Gespann mit roten Kühen,
Du Sel'ge, die du weit und breit dich ausdehnst.
Sie scheucht die Feinde, wie ein Held mit Schleudern,
Und schlägt das Dunkel wie ein Wagenkämpfer.
Bequeme Pfade hast du selbst auf Bergen
Und schreitest, selbsterleuchtend, durch die Wolken.
So bring uns, Hohe, denn auf breiten Bahnen
Gedeihn und Reichtum, Göttin Morgenröte.
Ja, bring uns doch, die du mit deinen Rindern
Das Beste führest, Reichtum nach