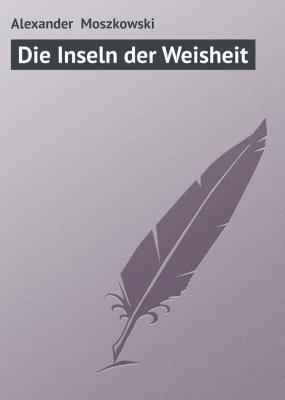Die Inseln der Weisheit. Alexander Moszkowski
Читать онлайн.| Название | Die Inseln der Weisheit |
|---|---|
| Автор произведения | Alexander Moszkowski |
| Жанр | Зарубежная классика |
| Серия | |
| Издательство | Зарубежная классика |
| Год выпуска | 0 |
| isbn |
– Mir ist der Zweck der Fragestellung immer noch dunkel.
»Lassen Sie sich das an Beispielen erklären. Gesetzt, wir fänden in unseren Statistiken, daß eine bestimmte Art von Vergehen oder Verbrechen mit besonderer Häufigkeit auf Personen entfällt, die sich etwa zu Spinoza bekennen, so würden wir auf theoretische Maßregeln zu sinnen haben, die dem Spinozismus entgegenwirken. Fänden wir wiederum, daß die pünktlichsten Steuerzahler unter den Anhängern des Cartesius angetroffen werden, so wäre uns das ein Wink in unseren Schulen und Akademien den Descartes zu bevorzugen. Sie dürfen nie aus den Augen verlieren, daß diese Insel durchaus nach dem Prinzip Platos eingerichtet ist, der ausdrücklich alle Staatsmacht den Philosophen zuweist und der kategorisch verlangt, daß das gesamte Getriebe des Gemeinwesens philosophisch reguliert wird.«
Wir füllten nunmehr die fragliche Rubrik aus. Herr Mac Lintock flüsterte mir zu, er wäre hier in Verlegenheit, da er sich zeitlebens noch nie um Philosophie gekümmert hätte. Ich gab ihm halblaut die Weisung, hinzuschreiben: »Pragmatismus nach William James«, denn diese neuamerikanische Denkform beruhe auf dem common sense, auf der praktischen Nützlichkeit, und stünde als philosophische Lehre sicherlich seiner eigenen kaufmännischen Praxis nahe. Seine Nichte bezeichnete sich auf dem Zettel kurzweg als Schopenhauerianerin; der Kapitän und Donath nannten sich Epikuräer; der Offizier und der Arzt bezeichneten irgendwelche andere berühmte Namen, und ich selbst schrieb kurzerhand, um uns auf alle Fälle gut Wetter zu machen »Plato«; obschon ich überzeugt war und bin, daß man sich überhaupt nicht einem einzelnen Philosophen verschreiben darf, da jeder nur eine Profillinie der Wahrheit darstellt, deren volles Gesicht erst in der Vereinigung aller Philosophien erkennbar wird.
Da es gerade Vesperzeit war, verfügten wir uns auf die Veranda zum Kaffeetisch, woselbst sich noch ein Schwager unseres Wirtes, Rektor einer Oberschule, angefunden hatte. Die Gattin des Herrn Yelluon ließ sich mit Unwohlsein entschuldigen. Sie lag zu Bett und fühlte sich so angegriffen, daß sie auf ihren sanften Kissen die gewohnten Dialoge des Plato nicht in der griechischen Urschrift, sondern nur in einer erleichternden Übersetzung zu lesen vermochte. Ich schalte ein, daß Balëuto einen Kaffee hervorbringt, gegen den die erlesensten Sorten unserer Kontinente nur als fade Substanzen zur Erzeugung von Spülichtwasser erschienen. Mir war dieser Umstand nicht ganz nebensächlich, denn zu gewissen Tagesstunden neige ich mehr zu einem exquisiten Jausegetränk in Begleitung einer duftigen Zigarette, als zu allen Offenbarungen der Eleaten und der Alexandrinischen Schule. Mit dem Rauchwerk freilich hatten wir nun wieder das Übergewicht. Denn die Insel war arm an Tabak, und auf der Atalanta steckten unerschöpfliche Vorräte Habaneser und Ägyptischer Herkunft. Ich erwähne dies, um einfließen zu lassen, daß wir schon auf Grund dieser Ladung ein vorzügliches Tausch- und Verkehrsmittel in der Hand hatten; obendrein wurde auch der Dollar späterhin als Zahlung angenommen, allerdings zu einem Valutakurs, bei dem sich selbst auf dem Haupte eines Dollarkönigs wie Mac Lintock die Haare sträuben konnten.
Eine lebhafte Unterhaltung kam in Gang, und der Rektor erzählte uns Wissenswertes aus seiner Schulpraxis. Es wäre zurzeit sehr schwierig, die Aufmerksamkeit der Schüler zusammenzuhalten, da diese mit ihren Erwartungen sich bereits in die bevorstehenden großen Festlichkeiten eingesponnen hätten.
»Ja, wir haben von dem Fest schon gehört, als wir landeten; was hat es damit für eine Bewandtnis?«
»Es ist das Hundertjahrjubiläum unserer Platonischen Akademie, aus der alle unsere Regenten und Minister hervorgegangen sind. Damals, bei der Stiftung, wurde auf unsere Stadt der Titel »Über-Athen« geprägt, und diese Bezeichnung ist ihr bis zur Stunde erhalten geblieben. Stünden Perikles und Phidias heut auf und wandelten sie unter uns, so müßten sie bekennen, daß ihr Alt-Athen, einst die Quelle aller Kultur, mit dem unsrigen verglichen das reine Banausendorf gewesen ist. Wie gut haben Sie es getroffen, daß Sie beim ersten Einblick in unseren Archipelagus ein solches Fest erleben! Sie werden natürlich an dem Aktus in der Aula teilnehmen und vom Balkon der Akademie aus den großen Festzug bewundern, bei dem auch die Fröhlichkeit zu ihrem Recht gelangen soll… Ja, wie gesagt, auch unsere Schüler sind bei den Proben beschäftigt und mit solcher Leidenschaft dabei, daß ich einen Teil der lateinischen und griechischen Unterrichtsstunden ausfallen lassen mußte.« »Eine Zwischenfrage, Herr Rektor,« warf Eva ein, »was betreiben Sie eigentlich sonst in diesen Lektionen? Lesen Sie mit ihren Schülern auch die Klassiker?«
»Selbstverständlich. Ich traktiere besonders den Horaz und den Homer.«
»Verzeihung, das ist mir nicht ganz verständlich. Ich empfinde hier einen Widerspruch: denn nach Plato dürfen Sie das gar nicht. Plato hat meines Wissens für seinen Idealstaat die Verbannung aller Dichter ausdrücklich verordnet!«
»Wie Sie Bescheid wissen, mein Fräulein! Ja, so steht es allerdings in Platons Staatsbuch. Und ich kann nicht verhehlen, daß uns dieser Befehl viele Jahrzehnte lang die peinlichste Beklemmung auferlegt hat. Es möge dahingestellt bleiben, ob der göttliche Plato seine Bestimmung ganz wörtlich verstanden wissen wollte …«
»O nein, Herr Rektor,« sagte ich, »darüber ist gar kein Zweifel erlaubt. Ich habe erst gestern auf unserem Schiff, das eine stattliche Bibliothek mitführt, in Platos grundlegendem Werk geblättert und entsinne mich der Stellen ganz genau. Plato, vertreten durch seinen Sprecher Sokrates, polemisiert auf das heftigste gegen alle bloß der Eitelkeit und der Wollust dienenden Personen, Künste und Lebensarten, die eine verdammenswerte Üppigkeit befördern und deshalb in seinem Idealstaat nicht geduldet werden dürfen. Scharf eifert er gegen die Maler und Bildner, gegen die Tonkünstler und ganz besonders gegen die Poeten, mit ihren Dienern, den Schauspielern, Rhapsoden und Tänzern, welche in einem gesunden Gemeinwesen nichts zu schaffen hätten. Diese Schädlinge stellt er auf eine Stufe mit den verderblichen Gilden der Putzmacherinnen, Haarkräuslerinnen, Bartscherer, Garköche und Schweinehirten…«
»Daraus ersehen Sie schon,« unterbrach der Rektor, »daß Plato nicht unerbittlich auf seinem Schein steht, denn er selbst, der Mann der Symposien, ließ sich ja wohlschmecken, was aus dem Gehege der Schweinehirten entstammte und durch athenische Garköche lecker zubereitet wurde.«
– Mit Verlaub, Herr Rektor: Sie kopieren auf Ihrer vortrefflichen Insel nicht Alt-Athen in concreto, sondern Sie wollen das Wunder leisten, ein Ideal-Athen aus der Abstraktion in die Wirklichkeit zu heben. Und da können Sie doch an den klaren Anweisungen Platos gar nicht vorbei: Kein Erbarmen mit den Dichtern! so lehrt er. Homer und Hesiod müssen vertilgt werden! Ihre Gesänge sind nicht, wie man vordem glaubte, als heilige, von den Musen erflossene Eingebungen anzusehen, sondern als mit rohen, pöbelhaften Begriffen und Gesinnungen durchsetzte, abgeschmackte Märchen, in denen die höchst unsittlichen Reden und Taten der Götter eine entsetzliche Moralfäulnis ausstrahlen. Und daraus folgt, streng nach Plato: Fort mit Homer und Hesiod, fort überhaupt mit aller Poesie und sämtlichen verdammten Künsten!
Der Schulmann entgegnete: »Wir beugen uns selbstverständlich der Autorität unseres erhabenen Meisters – soweit es eben möglich ist. Allein wir gelangen an den Punkt, wo die Unmöglichkeit beginnt. Denn um Plato und die übrigen großen Philosophen zu verstehen, bedürfen wir des Griechisch-Lateinischen, und dieses Studium würde blöde und stümperhaft ausfallen, ohne die klassischen Dichter. Wir lesen sie deshalb aus sprachlichen, das heißt grammatischen Gründen. Wir erziehen unsere Jünglinge und Mädchen zur Verachtung dieser Klassizitäten, aber wir lesen sie mit ihnen aus gymnasialen Gründen. Ich will Ihnen eine Probe dieser Methode mitteilen. Vor einigen Tagen begann ich mit den Zöglingen die Ode des Horaz
Exegi monumentum aere perennius…
(Dauerhafter als Erz schuf ich mein Ehrenmal);
ich nahm die Gelegenheit wahr, um generell meinen Abscheu vor Horaz und seiner skandierenden Gilde auszusprechen, und wandte mich dem ersten Worte zu: »Exegi«; ich erläuterte ausführlich die Herkunft des Ausdrucks aus ex und einer griechischen Wurzel ago, betrachtete dann die Präsensform exigo mit dem kurzen i, das sich im Praeteritum exegi mit elastischer Phonetik zu einem langvokalisierten e verzaubert, und erörterte dann ausführlich alle Autoren, die außer Horaz das nämliche Verbum in zahlreichen Abstufungen der Bedeutung