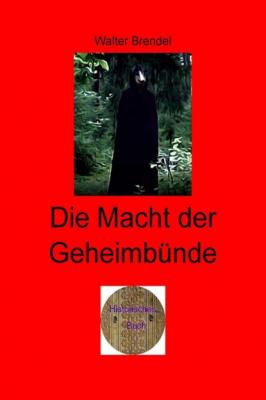Die Macht der Geimbünde. Walter Brendel
Читать онлайн.| Название | Die Macht der Geimbünde |
|---|---|
| Автор произведения | Walter Brendel |
| Жанр | Социология |
| Серия | |
| Издательство | Социология |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783754962060 |
Ebenso die Charbonniers im östlichen Frankreich, deren Propaganda in Italien die Carbonari ins Leben rief. In Deutschlandhatte sich unter der napoleonischen Herrschaft die Idee desnationalen Widerstands zunächst 1808 in den Tugendbund geflüchtet, dessen Satzungen übrigens der Staatsregierung bekannt waren, und der bereits am 31. Dezember 1809 wiederaufgelöst wurde. Er gab anschließend noch mehrere Jahre den Namen her für alle antifranzösische Agitation in Deutschland. Wirkliche Geheimbünde deutscher Patrioten waren der Friedrich Ludwig Jahn und Karl Friedrich Friesen 1810 gegründete Deutsche Bund, der Eiserne Bund, der Bund der Charlottenburger und andere. Wie in Deutschland und Italien bildeten sich auch anderwärts Geheimbünde mit durchaus nationaler Tendenz, insbesondere als mit dem Sieg über den verhassten Napoleon das Legitimitätsprinzip zu neuer Geltung kam. Einen entschieden nationalen Charakter hatte die 1795 gestiftete und1814 erneuerte Hetärie der Griechen zur Befreiung von der türkischen Herrschaft und die seit 1817 in Polen gestifteten Geheimbünde unter den Namen des Patriotischen Vereins, den Bundes der Sensenträger, der Strahlende, der Philareten und der Templer. Die teilweise Entdeckung der Templer führte zu ihrem Zusammengehen mit dem Patriotischen Verein. Der missglückte Ausbruch der Verschwörung der Dekabristen in St. Petersburg nach dem Tod Alexanders I. hatte dann auch die Auflösung des polnischen Patriotischen Vereins zur Folge, an dessen Stelle 1828 eine geheime Verbindung zunächst der Warschauer Militärschule entstand, die, zu einem Jünglingsbunde erweitert, den Anstoß zur polnischen Erhebung 1830 gab. Auch nach der Unterdrückung dieses Aufstands dauerten die zum Teil von der Emigration in Frankreich geleiteten Versuche zur Gründung revolutionärer Gesellschaften fort und führten zu den Aufständen von Krakau, Posen und zum Januaraufstand.
Im Westen und Süden Europas war das Ziel der Geheimbünde seit der Restauration von 1815 und der damit verbundenen Reaktion neben den erwähnten nationalen Einigungsabsichten auch auf die Einführung wirklich verfassungsmäßiger Zustände gerichtet. So hatten in Italien die Carbonari - weniger die Camorra und die Mafia - in Spanien die Freimaurer und Comuneros eine liberale, zum Teil demokratische Färbung.
In Frankreich bildeten sich solche Verbindungen zunächst im Interesse der napoleonischen Dynastie unter verschiedenen Namen, wie Verein der schwarzen Nadel, der Patrioten von 1816, der Geier Bonapartes, der Sonnenritter, der europäisch-reformistischen Patrioten und der Allgemeinen Regeneration. Diese verschmolzen mit den Carbonari, so dass Paris Hauptsitz der Charbonnerie wurde. Bald nach dem Frieden entstand auch in Deutschland, vor allem am Rhein entlang, eine vom früheren Tugendbund mancher entlehnenden geheimen Verbindung, die aber bald wieder einging. Später bildete sich aus der allgemeinen deutschen Burschenschaft ein Jugendbund (Unbedingte), zum Teil als Opposition gegen die so genannte Adelskette und gegen jesuitische Umtriebe.
Neuzeit 1830
Eine neue Phase in der Geschichte der Geheimbünde beginnt mit der französischen Julirevolution 1830. In Frankreich gingen aus der karlistischen Partei Gesellschaften hervor, wie die der Chevaliers de la legimité. Die republikanische Partei erzeugte eine neue Charbonnerie démocratique, und als Bestandteil der zahlreichen Gesellschaften der Menschenrechte bildete sich eine besondere Section d'action. Nachdem anschließend in Italien erneute revolutionäre Versuche gescheitert waren, stifteten mehrere Emigranten, u.a. Mazzini, in Opposition mit der französischen Charbonnerie, das Junge Italien. Nach dessen Vorbild entstand ein Junges Deutschland, Junges Polen, Junges Frankreich und eine Junge Schweiz, die alle als Junges Europa in gegenseitigen Austausch zu treten suchten.
Nach dem Tod Ferdinands VII. 1833 bildeten sich in Spanienaus den Überresten früherer Vereine, aus der Carbonaria und dem Jungen Europa eine Menge geheimer Gesellschaften, wieder der Isabellinos, der Hohen Templer, der Menschenrechte, der unregelmäßigen Freimaurer und das in Barcelona gegründete Junge Spanien. Diese Vereine bezweckten entweder nur eine Abwehr des karlistischen Despotismus und der Priesterherrschaft oder sie gingen auf die Wiederherstellung der Konstitution von 1812 oder der Republik aus. Ihnen gegenüber traten mehrere karlistische Vereine auf, wie die Sonnenritter, während der gemäßigte Liberalismus der Gesellschaft der Jovellanisten zuneigte. In ähnlicher Weise tauchten in Portugal Verbindungen der Septembristen, Charlisten und Miquelisten auf, die zeitweise verschwanden und unter neuen Namen und Formen wiederauftauchten.
In Deutschland nahm ein Teil der Burschenschaft schon vor dem Frankfurter Attentat als Germania die Gestalt einer geheimen Verbindung an. Nicht lange nach jenem Attentat bildete sich in Frankfurt am Main und Umgebung ein Männerbund mitdemokratischer Tendenz.
In England traten die schon lange gegründeten torystischen Orangelogen immer entschiedener hervor. Ebenso waren in Irland seit dem 18. Jahrhundert geheime politische Organisationen unter abenteuerlichen Namen aktiv:
• seit 1760 die Whiteboys
• die Rightboys
• die Shanvests
• seit 1722 die Hearts of Steel
• die Corders
• die Caravak
• die Oak Boys and Treffers
• seit 1781 die United Irishmen
• 1817 die Bandmänner.
Diese Gruppen hatten eine agrarische Neuorganisation und politische Unabhängigkeit Irlands zum Zweck. Neben den öffentlichen Vereinen (Gewerkschaften) der Arbeiter in Großbritannien und Irland und dem Chartismus bildeten sich auch Geheimbünde, die aber mehr auf Erlangung höherer Lohnsätze als auf politische Ziele ausgingen. Überhaupt konnten in der britischen Gesellschaft politische Geheimbünde schon deshalbweniger tiefe Wurzeln schlagen, weil das Vereins- und Versammlungsrecht bereits gesetzlich anerkannt war.
Frankreich blieb im Weiteren der Hauptherd der Geheimen Gesellschaften. Nachdem dort die Republikanische Partei im Aufstand von 1834 eine schwere Niederlage erlitten hatte, entstanden die zahlreichen Vereine, die eine Verwirklichung des Sozialismus oder des Kommunismus zum Ziel hatten. Auch in einigen deutschen Staaten entdeckte man seit 1840 einige geheime, meist von Handwerkern gestiftete Vereine, die ähnliche Tendenzen aufzuweisen schienen. Diese Bestrebungen warenteilweise über die Schweiz hereingetragen worden, wo man1843 nach einer umfangreichen Untersuchung in Zürich kommunistische Verbände aufdecken konnte.
Einzelne Begriffe zur Herkunft, Gründung und Struktur
Ordensgemeinschaft
Eine Ordensgemeinschaft (auch Orden, von lat. ordo: Ordnung, Stand) ist eine durch eine Ordensregel verfasste Lebensgemeinschaft von Männern oder Frauen, die sich durch Ordensgelübde an ihre Lebensform binden und ein gemeinschaftliches religiöses Leben führen, beispielsweise in einem Kloster.
Francisco de Herrera der Ältere: Der Heilige Bonaventura tritt bei den Franziskanern ein (1628)
Von Ordensleuten zu unterscheiden sind Eremiten, die zwar oft Mönche bzw. Nonnen sind, aber als Einzelne ein Leben in der Einsamkeit führen, und andere traditionelle oder moderne Formen religiösen Lebens (etwa gottgeweihte Jungfrauen oder Witwen, Beginen und Begarden, Säkularinstitute, evangelische Diakonissen und Diakonengemeinschaften), die nicht in der Tradition des Ordenslebens stehen oder andersartig verfasst sind. Der im Deutschen außerhalb des kirchenrechtlichen Sprachgebrauchs allerdings wenig gebräuchliche Oberbegriff für alle, die eine der durch Gelübde oder bindendes Versprechen begründeten Formen eines gottgeweihten Lebens (lat. Vita consecrata) leben, lautet Religiosen bzw. gottgeweihte Personen.
In der römisch-katholischen (lateinischen) Kirche wird zwischen Orden im eigentlichen Sinn (länger als 700 Jahre bestehende Gemeinschaften, darunter Mönchsorden, Nonnenorden, geistliche Ritterorden, Bettelorden und Regularkanoniker), und Ordensgemeinschaften neuzeitlichen oder modernen Ursprungs(etwa seit dem 17. Jahrhundert) unterschieden. Letztere werden meist als Kongregationen bezeichnet. Diese Unterscheidung hatte im früheren Kirchenrecht große Bedeutung, spielt aber im heutigen Kodex kaum noch eine Rolle. Allerdings spiegeln sich die traditionellen Unterschiede zumeist im Eigenrecht der jeweiligen Gemeinschaften (bei Orden meist Regel, bei Kongregationen Konstitutionen genannt) wider.
Ordensgemeinschaften im westlichen