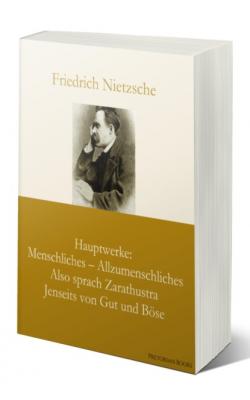Hauptwerke: Menschliches – Allzumenschliches, Also sprach Zarathustra, Jenseits von Gut und Böse. Friedrich Nietzsche
Читать онлайн.| Название | Hauptwerke: Menschliches – Allzumenschliches, Also sprach Zarathustra, Jenseits von Gut und Böse |
|---|---|
| Автор произведения | Friedrich Nietzsche |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783748558774 |
15. Kein Innen und Aussen in der Welt. – Wie Demokrit die Begriffe Oben und Unten auf den unendlichen Raum übertrug, wo sie keinen Sinn haben, so die Philosophen überhaupt den Begriff "Innen und Aussen" auf Wesen und Erscheinung der Welt; sie meinen, mit tiefen Gefühlen komme man tief in's Innere, nahe man sich dem Herzen der Natur. Aber diese Gefühle sind nur insofern tief, als mit ihnen, kaum bemerkbar, gewisse complicirte Gedankengruppen regelmässig erregt werden, welche wir tief nennen; ein Gefühl ist tief, weil wir den begleitenden Gedanken für tief halten. Aber der tiefe Gedanke kann dennoch der Wahrheit sehr fern sein, wie zum Beispiel jeder metaphysische; rechnet man vom tiefen Gefühle die beigemischten Gedankenelemente ab, so bleibt das starke Gefühl übrig, und dieses verbürgt Nichts für die Erkenntniss, als sich selbst, ebenso wie der starke Glaube nur seine Stärke, nicht die Wahrheit des Geglaubten beweist.
16. Erscheinung und Ding an sich. – Die Philosophen pflegen sich vor das Leben und die Erfahrung – vor Das, was sie die Welt der Erscheinung nennen – wie vor ein Gemälde hinzustellen, das ein für alle Mal entrollt ist und unveränderlich fest den selben Vorgang zeigt: diesen Vorgang, meinen sie, müsse man richtig ausdeuten, um damit einen Schluss auf das Wesen zu machen, welches das Gemälde hervorgebracht habe: also auf das Ding an sich, das immer als der zureichende Grund der Welt der Erscheinung angesehen zu werden pflegt. Dagegen haben strengere Logiker, nachdem sie den Begriff des Metaphysischen scharf als den des Unbedingten, folglich auch Unbedingenden festgestellt hatten, jeden Zusammenhang zwischen dem Unbedingten (der metaphysischen Welt) und der uns bekannten Welt in Abrede gestellt: so dass in der Erscheinung eben durchaus nicht das Ding an sich erscheine, und von jener auf dieses jeder Schluss abzulehnen sei. Von beiden Seiten ist aber die Möglichkeit übersehen, dass jenes Gemälde – Das, was jetzt uns Menschen Leben und Erfahrung heisst – allmählich geworden ist, ja noch völlig im Werden ist und desshalb nicht als feste Grösse betrachtet werden soll, von welcher aus man einen Schluss über den Urheber (den zureichenden Grund) machen oder auch nur ablehnen dürfte. Dadurch, dass wir seit Jahrtausenden mit moralischen, ästhetischen, religiösen Ansprüchen, mit blinder Neigung, Leidenschaft oder Furcht in die Welt geblickt und uns in den Unarten des unlogischen Denkens recht ausgeschwelgt haben, ist diese Welt allmählich so wundersam bunt, schrecklich, bedeutungstief, seelenvoll geworden, sie hat Farbe bekommen, – aber wir sind die Coloristen gewesen: der menschliche Intellect hat die Erscheinung erscheinen lassen und seine irrthümlichen Grundauffassungen in die Dinge hineingetragen. Spät, sehr spät – besinnt er sich: und jetzt scheinen ihm die Welt der Erfahrung und das Ding an sich so ausserordentlich verschieden und getrennt, dass er den Schluss von jener auf dieses ablehnt – oder auf eine schauerlich geheimnissvolle Weise zum Aufgeben unsers Intellectes, unsers persönlichen Willens auffordert: um dadurch zum Wesenhaften zu kommen, dass man wesenhaft werde. Wiederum haben Andere alle charakteristischen Züge unserer Welt der Erscheinung – das heisst der aus intellectuellen Irrthümern herausgesponnenen und uns angeerbten Vorstellung von der Welt – zusammengelesen und anstatt den Intellect als Schuldigen anzuklagen, das Wesen der Dinge als Ursache dieses thatsächlichen, sehr unheimlichen Weltcharakters angeschuldigt und die Erlösung vom Sein gepredigt. – Mit all diesen Auffassungen wird der stetige und mühsame Process der Wissenschaft, welcher zuletzt einmal in einer Entstehungsgeschichte des Denkens seinen höchsten Triumph feiert, in entscheidender Weise fertig werden, dessen Resultat vielleicht auf diesen Satz hinauslaufen dürfte: Das, was wir jetzt die Welt nennen, ist das Resultat einer Menge von Irrthümern und Phantasien, welche in der gesammten Entwickelung der organischen Wesen allmählich entstanden, in einander verwachsen [sind] und uns jetzt als aufgesammelter Schatz der ganzen Vergangenheit vererbt werden, – als Schatz: denn der Werth unseres Menschenthums ruht darauf. Von dieser Welt der Vorstellung vermag uns die strenge Wissenschaft thatsächlich nur in geringem Maasse zu lösen – wie es auch gar nicht zu wünschen ist –, insofern sie die Gewalt uralter Gewohnheiten der Empfindung nicht wesentlich zu brechen vermag: aber sie kann die Geschichte der Entstehung jener Welt als Vorstellung ganz allmählich und schrittweise aufhellen – und uns wenigstens für Augenblicke über den ganzen Vorgang hinausheben. Vielleicht erkennen wir dann, dass das Ding an sich eines homerischen Gelächters werth ist: dass es so viel, ja Alles schien und eigentlich leer, nämlich bedeutungsleer ist.
17. Metaphysische Erklärungen. – Der junge Mensch schätzt metaphysische Erklärungen, weil sie ihm in Dingen, welche er unangenehm oder verächtlich fand, etwas höchst Bedeutungsvolles aufweisen: und ist er mit sich unzufrieden, so erleichtert sich diess Gefühl, wenn er das innerste Welträthsel oder Weltelend in dem wiedererkennt, was er so sehr an sich missbilligt. Sich unverantwortlicher fühlen und die Dinge zugleich interessanter finden – das gilt ihm als die doppelte Wohlthat, welche er der Metaphysik verdankt. Später freilich bekommt er Misstrauen gegen die ganze metaphysische Erklärungsart, dann sieht er vielleicht ein, dass jene Wirkungen auf einem anderen Wege eben so gut und wissenschaftlicher zu erreichen sind: dass physische und historische Erklärungen mindestens ebenso sehr jenes Gefühl der Unverantwortlichkeit herbeiführen, und dass jenes Interesse am Leben und seinen Problemen vielleicht noch mehr dabei entflammt wird.
18. Grundfragen der Metaphysik. – Wenn einmal die Entstehungsgeschichte des denkens geschrieben ist, so wird auch der folgende Satz eines ausgezeichneten Logikers von einem neuen Lichte erhellt dastehen: "Das ursprüngliche allgemeine Gesetz des erkennenden Subjects besteht in der inneren Nothwendigkeit, jeden Gegenstand an sich, in seinem eigenen Wesen als einen mit sich selbst identischen, also selbstexistirenden und im Grunde stets gleichbleibenden und unwandelbaren, kurz als eine Substanz zu erkennen." Auch dieses Gesetz, welches hier "ursprünglich" genannt wird, ist geworden: es wird einmal gezeigt werden, wie allmählich, in den niederen Organismen, dieser Hang entsteht, wie die blöden Maulwurfsaugen dieser Organisationen zuerst Nichts als immer das Gleiche sehen, wie dann, wenn die verschiedenen Erregungen von Lust und Unlust bemerkbarer werden, allmählich verschiedene Substanzen unterschieden werden, aber jede mit Einem Attribut, das heisst einer einzigen Beziehung zu einem solchen Organismus. – Die erste Stufe des Logischen ist das Urtheil; dessen Wesen besteht, nach der Feststellung der besten Logiker, im Glauben. Allem Glauben zu Grunde liegt die Empfindung des Angenehmen oder Schmerzhaften in Bezug auf das empfindende Subject. Eine neue dritte Empfindung als Resultat zweier vorangegangenen einzelnen Empfindungen ist das Urtheil in seiner niedrigsten Form. – Uns organische Wesen interessirt ursprünglich Nichts an jedem Dinge, als sein Verhältniss zu uns in Bezug auf Lust und Schmerz. Zwischen den Momenten, in welchen wir uns dieser Beziehung bewusst werden, den Zuständen des Empfindens, liegen solche der Ruhe, des Nichtempfindens: da ist die Welt und jedes Ding für uns interesselos, wir bemerken keine Veränderung an ihm (wie jetzt noch ein heftig Interessirter nicht merkt, dass jemand an ihm vorbeigeht). Für die Pflanze sind gewöhnlich alle Dinge ruhig, ewig, jedes Ding sich selbst gleich. Aus der Periode der niederen Organismen her ist dem Menschen der Glaube vererbt, dass es gleiche Dinge giebt (erst die durch höchste Wissenschaft ausgebildete Erfahrung widerspricht diesem Satze). Der Urglaube alles Organischen von Anfang an ist vielleicht sogar, dass die ganze übrige Welt Eins und unbewegt ist. – Am fernsten liegt für jene Urstufe des Logischen der Gedanke an Causalität : ja jetzt noch meinen wir im Grunde, alle Empfindungen und Handlungen seien Acte des freien Willens; wenn das fühlende Individuum sich selbst betrachtet, so hält es jede Empfindung, jede Veränderung für etwas Isolirtes, das heisst Unbedingtes, Zusammenhangloses: es taucht aus uns auf, ohne Verbindung mit Früherem oder Späterem. Wir haben Hunger, aber meinen ursprünglich nicht, dass der Organismus erhalten werden will, sondern jenes Gefühl scheint sich ohne Grund und Zweck geltend zu machen, es isolirt sich und hält sich für willkürlich. Also: der Glaube an die Freiheit des Willens ist ein ursprünglicher Irrthum alles Organischen, so alt, als die Regungen des Logischen in ihm existiren; der Glaube an unbedingte Substanzen und an gleiche Dinge ist ebenfalls ein ursprünglicher, ebenso alter Irrthum alles Organischen. Insofern aber alle Metaphysik sich vornehmlich mit Substanz und Freiheit des Willens abgegeben hat, so darf man sie als die Wissenschaft bezeichnen, welche von den Grundirrthümern des Menschen handelt, doch so, als wären es Grundwahrheiten.
19. Die Zahl. – Die Erfindung der Gesetze der Zahlen ist auf Grund des ursprünglich schon herrschenden Irrthums gemacht, dass es mehrere gleiche Dinge gebe (aber thatsächlich giebt es nichts Gleiches), mindestens dass es Dinge gebe (aber es giebt kein "Ding"). Die Annahme der Vielheit setzt immer voraus,