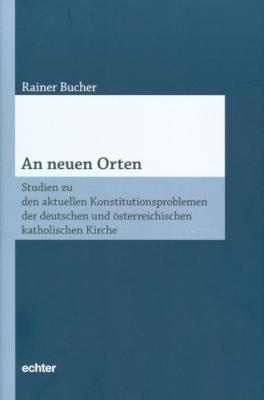An neuen Orten. Rainer Bucher
Читать онлайн.| Название | An neuen Orten |
|---|---|
| Автор произведения | Rainer Bucher |
| Жанр | Документальная литература |
| Серия | |
| Издательство | Документальная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783429061623 |
Die „Kirche der Frauen“ ist eine Zumutung für die patriarchale Kirche, denn jene ist neu und ungewohnt für diese, sie weiß nicht mit ihr umzugehen und kann sich zu ihr nicht in ein kreatives Verhältnis setzen. Die patriarchale Kirche ist aber auch eine Zumutung für die „Kirche der Frauen“, denn jene schätzt sie nicht, gibt ihr keine Macht und neigt dazu, ihre personale Ernsthaftigkeit, religiöse Qualität und evangelisatorische Potenz zu unterschätzen.
Die „Kirche der Frauen“ ist aber auch eine unausweichliche Größe für die patriarchale Kirche, denn ohne jene ist sie nicht zukunftsfähig, kann sie das Evangelium bei den Frauen nicht verkünden und noch weniger entdecken und letztlich ihre eigene Existenz nicht sichern. Die patriarchale Kirche ist aber auch eine unausweichliche Größe für die „Kirche der Frauen“, denn diese entstammt jener, teilt mit ihr viele Traditionen und kann sich nur mit Bezug auf sie ihrer eigenen Herkunft versichern.
Hildegard Wustmans, frühere Dezernatsleiterin in der Diözese Limburg und jetzt Pastoraltheologin in Linz, hat in ihrer Grazer Habilitationsschrift192 die Kategorie der „Balance“ vorgeschlagen, um das Verhältnis der „Kirche der Frauen“ zum traditionellen kirchlichen Raum zu beschreiben. Balancen sind heikle Angelegenheiten und für sie sind immer beide Seiten verantwortlich. Sie gehen leichter verloren, als man sie einrichtet, und sie sind nie gesichert. Zudem sind sie anstrengend. Hat man sie aber einmal gefunden, ermöglichen sie das schier Unmögliche: Dinge ins Schweben zu bringen, die ständig zu kippen drohen – und dann einfach liegen bleiben.
Es geht nicht um Utopien, sondern, mit einem Begriff von Foucault, um Andersorte, Heterotopoi.193 Das sind, anders als Utopien, Orte, die es tatsächlich gibt, die aber eine Differenz zu ihrer Umgebung setzen und dadurch verschämte oder verschwiegene Wahrheiten ans Licht bringen. Bei Foucault sind Friedhöfe und Bordelle klassische Heterotopoi. Sie sind ausgegrenzt und bringen verschwiegene Wahrheiten ans Licht: hier etwa die Unausweichlichkeit und also Macht des Todes wie der Sexualität.
Solche Orte gibt es schon. Man sollte sie nicht verstecken, sondern ausstellen und herzeigen. Denn sonst sprechen sie nicht, obwohl sie viel zu sagen hätten.
1935 – 1970 – 2009
Ursprünge, Aufstieg und Scheitern der „Gemeindetheologie“ als Basiskonzept pastoraler Organisation der katholischen Kirche
1 Gemeindetheologie: Definition und Charakteristika
Die katholische Kirche Deutschlands – und in anderer Form auch die evangelische – bewegt seit einiger Zeit kaum etwas mehr als der ressourcenbedingte Umbau ihrer pastoralen Basisstruktur. Die Konfliktlinie verläuft dabei im Wesentlichen zwischen den Anhängern der „Gemeindetheologie“ und den Pastoralplanern der Seelsorgeämter, die, so jedenfalls im katholischen Bereich, die wenigen verbliebenen Priester auf einer höheren Ebene des kirchlichen Stellenkegels ansiedeln müssen und daher das lange propagierte Idealbild einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal umschriebenen, kommunikativ verdichteten Glaubensgemeinschaft auflösen.194
So lange freilich existiert dieses gemeindliche Idealbild kirchlicher Basisorganisation im katholischen – und übrigens auch im evangelischen – Bereich noch gar nicht. Dessen Aufstieg ab 1970, sein Anfang in den 1930er Jahren, die Modifikationen, die es dabei durchmachte sowie die aktuelle Lage der Gemeindetheologie im Bereich der deutschsprachigen katholischen Kirche sollen im Folgenden nachgezeichnet werden. Es geht dabei primär um eine diskursive, nicht um eine soziale Größe, wenn auch der pastoraltheologische Diskurs seit Maria Theresias Gründungszeiten des Faches nicht mehr so erfolgreich gewesen sein dürfte wie bei der realen Durchsetzung der Gemeindetheologie als quasi selbstverständliche Normalform kirchlicher Basisverfassung.
Gemeindetheologie meint dabei das, was Petro Müller, einer ihrer vehementesten Verteidiger, mit Blick auf ein prominentes Beispiel der Nachkonzilszeit, die Wiener „Machstraße“, in den programmatischen Satz zusammenfasst: „Überschaubare Gemeinschaften mündiger Christen sollten die anonymen Pfarrstrukturen aufbrechen und an ihre Stelle treten.“195 Zentrale Bezugsgröße der Kirchenmitgliedschaft ist in der Gemeindetheologie nicht mehr, wie eigentlich katholisch programmatisch üblich und in der Pianischen Epoche auch sozial weitgehend realisiert, die römisch-katholische Gesamtkirche mit dem Papst an der Spitze, sondern der überschaubare Nahraum einer kommunikativ verdichteten, letztlich nach dem Modell einer schicksalhaft verbundenen Großfamilie gedachten „Gemeinde“.
2 Der Aufstieg: Gemeindetheologie 1970
„Gemeinde“ ist im Horizont der verschärften konfessionellen Differenz des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts alles andere als ein genuin katholischer Begriff. Der Wiener Pastoraltheologe Ferdinand Klostermann (1907-1982) berichtet, dass noch 1968 ein Jesuit in den „Räumen der Wiener Katholischen Hochschulgemeinde“ ihm entgegnet habe, „Gemeinde sei eigentlich eine eher protestantische Vokabel, die man im katholischen Bereich vermeiden sollte“196. Freilich, so schreibt Klostermann dann 1970, mittlerweile sei „Gemeinde … wie über Nacht eine katholische Vokabel, ja geradezu eine katholische Modevokabel geworden.“197
Erst Anfang der 1970er Jahre, so lässt sich aus Klostermanns Bemerkung schließen, setzte sich offenbar die „Gemeindetheologie“ endgültig und sehr schnell auch im katholischen Bereich durch. Es musste also vorher ein anderes Paradigma kirchlicher Basisorganisation geherrscht haben. Im 4. Band des „Lexikons für Theologie und Kirche“ aus dem Jahre 1960 wird denn auch unter dem Stichwort „Gemeinde“ noch schlicht auf „Pfarrei“ bzw. auf „Kirche“ verwiesen, ausgeführt waren nur das „protestantische Glaubensverständnis“ und die „Rechtsgeschichte“.198
Wer ist dieser Ferdinand Klostermann, der hier durchaus zutreffend den Sieg der Gemeindetheologie auch im katholischen Bereich konstatiert? Zum einen, er ist jener Theologe, der für diesen Sieg wie kaum ein anderer verantwortlich war. Ferdinand Klostermann, von 1962 bis 1977 Ordinarius für Pastoraltheologie an der Wiener Katholisch-Theologischen Fakultät,199 kann als zentraler Theoretiker wie als Initiator der nachkonziliaren Gemeindetheologie gelten. Er war ohne Zweifel einer der einflussreichsten Theologen seiner Zeit und das weit über Österreich hinaus.
Von den im Lande geborenen österreichischen Theologen ist nur einer nach dem Zweiten Weltkrieg in der ganzen Welt bekannt geworden: Ferdinand Klostermann. Das ist wohl unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich mit seinem Namen die Leitidee für die Seelsorge nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verbindet, nämlich die christliche Gemeinde200
– so der Linzer Pastoraltheologe und Freund Klostermanns, Wilhelm Zauner, in einem Rückblick auf Klostermanns Leben 1987.
Der gemeindetheologische Diskurs Klostermanns reagiert deutlich auf die Säkularisierungserfahrungen des sich auflösenden katholischen Milieus in der Modernisierungswelle der frühen 60er Jahre. Man wollte der schon seit längerem, nunmehr aber unübersehbar nachlassenden Bindekraft der katholischen Kirche gegensteuern. Für Klostermann spielt die These, „dass im allgemeinen der Kirchenbesuch mit der wachsenden Pfarreigröße abnimmt“, eine zentrale Rolle in der Begründung seines gemeindetheologischen Projekts. Er entwickelt aus diesem Befund „die pastorale Notwendigkeit von Pfarrteilungen bzw. gemeindlichen Substrukturen unserer städtischen Großpfarreien“ und fordert auch die „Erhaltung der Kleinpfarreien … als echte Gemeinden“, auch „auf dem Lande.“201 Dieses Begründungsmuster findet sich im Übrigen praktisch identisch knapp ein Jahrhundert vorher im protestantischen Bereich, als auch dort gemeindetheologische Konzepte erst wirklich nachhaltig Fuß fassten.202
Der „fortschreitenden Säkularisierung“