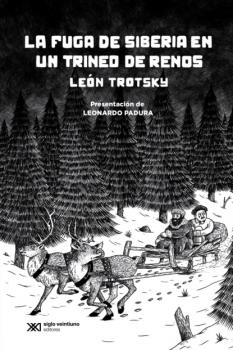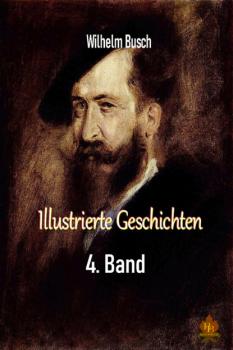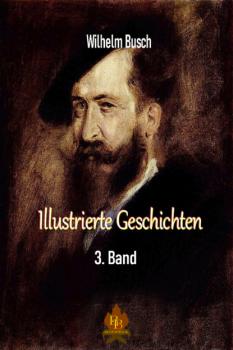Bookwire
Все книги издательства BookwireLa fuga de Siberia en un trineo de renos
Traducida al español por primera vez, La fuga de Siberia en un trineo de renos es la obra de un revolucionario impetuoso, sí, pero no tiene nada de alegato político o propaganda. Como protagonista de la Revolución de 1905, sofocada por el poder zarista, un Trotsky de 27 años es enjuiciado y deportado de por vida a Siberia. El destino final está situado sobre el Círculo Polar Ártico, a 1600 km de la estación de tren más cercana. En una de las postas del trayecto, el prisionero inicia la fuga a través de la estepa siberiana, territorio salvaje y extremo, con temperaturas por debajo de los -25 ºC y poblaciones con costumbres, penurias y solidaridades que él no conoce. Este es el relato en primera persona de esas jornadas extenuantes, llenas de acechanzas. Temiendo cada minuto por su captura y confiando su vida y su libertad al imprevisible cochero Nikifor, que no para de beber, Trotsky se convierte, acaso contra su voluntad, en un viajero. Transita por la tundra, se fascina con los renos, pasa las noches junto al fuego como un siberiano nómade más, urde estrategias para no ser reconocido, toma notas mientras se asegura de tener a mano el revólver como último recurso para defenderse. Diario de viaje escrito sobre la marcha, agitado por el suspenso y la expectativa, La fuga de Siberia… nos muestra la intimidad del joven Trotsky, y a un narrador literario en estado puro.
Neurociencia en la escuela
Las neurociencias están de moda. En su nombre, con el dedo en alto y tono profético, se les dice a los docentes lo que deben hacer y cómo hacerlo para lograr el tan anhelado tesoro: que los estudiantes aprendan. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de mito en lo que se pregona? ¿Es puro palabrerío para vestir con nuevas ropas a las mismas recetas de siempre?
Aprender es modificar el cerebro, dice la autora de este libro. Y es que el cerebro tiene una propiedad deslumbrante: se transforma con la experiencia. Pero para que el aprendizaje ocurra hace falta que se den ciertas condiciones. Algunas circunstancias pueden facilitarlo y otras, hacerlo más difícil. Lo cierto es que en las últimas décadas las neurociencias crearon un cuerpo de conocimiento sólido sobre los procesos que nos permiten a nosotros, humanitas y humanitos, incorporar saberes, desarrollar habilidades, resolver problemas y pensar creativamente. Es por eso que, con toda prudencia y respeto por la labor y el saber de los educadores, hoy hay un montón de ciencia que puede ayudar a pensar el trabajo en el aula y ofrecer herramientas valiosas.
Joven pionera en esto de combatir mitos y acercar la ciencia del cerebro a la educación, Andrea Goldin nos ayuda a entender, en términos simples y amables, qué pasa cuando aprendemos, tanto en la escuela como a lo largo de toda la vida. Sin falsas promesas y sobre todo sin arrogancia, responde a las preguntas centrales: ¿Por qué la nutrición, el sueño o el juego son fundamentales? ¿Cómo funciona la memoria y qué papel cumple la atención? ¿Qué es la flexibilidad? ¿Cómo decidimos qué información procesamos y cuál dejamos pasar? ¿Cómo intervienen las emociones? También, cosas mucho más prácticas y concretas: ¿Por qué algunos aprendizajes son más profundos? ¿Qué hace que un recuerdo sea perdurable? ¿Sirve estudiar de memoria? Y hasta cómo conviene periodizar el estudio.
Pero Neurociencia en la escuela no se concentra solo en el aprendizaje: propone también una neurociencia de la enseñanza, que ubica al docente en el centro. Y lo mejor de todo es que, sobre la base de estos conocimientos, maestros y maestras (¡y todos en general!) podemos hacer mucho en nuestra búsqueda de aprender y enseñar mejor.
Realidad de la virtualidad
El presente volumen reúne artículos de investigadores/as de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones universitarias, enfocados en el estudio del espacio y la inmersividad en tanto objetos de estudio. Se indagan las posibilidades epistemológicas y ontológicas que ambas nociones abren para pensar las prácticas artísticas contemporáneas. Organizado en tres secciones problematiza el binomio realidad-virtualidad desde diversas perspectivas que incluyen la neurociencia, la fenomenología, la estética de la computación, el diseño, el poshumanismo, los estudios sobre la realidad virtual y la música acusmática; y en contextos como el net art, el arte postinternet y la presencia de la inteligencia artificial en las artes. De esta manera, el volumen busca contribuir y robustecer la literatura comprometida con la problematización, el análisis y la comprensión de las nociones de espacio e inmersividad desde la filosofía, la ciencia y el arte, a la luz de los diferentes cambios culturales que ocurren de acuerdo con la lógica del mundo contemporáneo en lo que respecta a la realidad y la virtualidad.
Inspiration 1/2022
Wie viele Pläne mussten Sie und haben Sie in den letzten zwei Jahren umgeworfen? Machen Sie noch Pläne, oder sind Sie es leid? Die Coronapandemie hat uns Menschen sehr deutlich gemacht, dass unsere Planungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Planen scheint keine wichtige Fähigkeit mehr zu sein – Improvisieren wird wichtiger. Und doch ist das Planen eine Grundform menschlicher Tätigkeit. Wir kennen Abläufe, haben Träume und organisieren Projekte, wiederholen notwendige Tätigkeiten. Umso schwieriger, wenn Pläne durchkreuzt werden, große Planungen umgeworfen werden müssen, nichts so läuft wie gedacht … In diesem Heft schauen wir aus verschiedenen Perspektiven auf das Planen und die Pläne: Aus Perspektive der geistlichen Begleitung geht Sonja Knapp der Aufgabe und der Möglichkeit der geistlichen Begleitung nach, wenn die eigenen Pläne scheitern und die Frage nach Gottes Plänen sperrig ins eigene Leben ragt. Nicht nur die Pläne der Menschen müssen manchmal überarbeitet werden. Auch Gottes Pläne scheinen manches mal verändert werden zu müssen. Barbara Leicht wirft inspirierende Blicke in die biblischen Schriften und eröffnet die Reihe ›Biblische Impulse‹. Mit Renate Wagner schauen wir auf die Pläne am Ende des Lebens. Was bedeutet eigentlich Planen für Menschen und ihre Angehörigen im Hospiz. Pfr. Walter Mückstein stellt uns die großen Exerzitien des Ignatius von Loyola vor und seinen Plan von einer Suche nach den Plänen Gottes im eigenen Leben. Am Ende des Heftes steht ein Predigtimpuls zu einem Text aus dem Römerbrief mit der Zusage »Du bist Gottes geliebtes Kind – auch wenn deine Pläne scheitern.«
Erzählungen aus 1001 Nacht - 5. Band
Wir lesen im 5. Band die Geschichten der Zweihundertneunundsechzigste bis dreihundertsiebenundsiebenzigste Nacht. Die Erzählungen aus Tausendundeine(r) Nacht sind eine Sammlung morgenländischer Texte und zugleich ein Klassiker der Weltliteratur. Typologisch handelt es sich um eine Rahmenerzählung mit Schachtelgeschichten. Aus Sicht der frühesten arabischen Leser hatte das Werk den Reiz der Exotik, es stammt für sie aus einem mythischen «Orient». Das Strukturprinzip der Rahmengeschichte sowie einige der enthaltenen Tierfabeln weisen auf einen indischen Ursprung hin und stammen vermutlich aus der Zeit um 250. So wird zwar ein indischer Ursprung vermutet, aber dass der Kern der Erzählungen aus Persien stammt, kann nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass zwischen dem indischen und persischen Kulturraum zu jener Zeit enge Beziehungen bestanden.
Illustrierte Geschichten - 4. Band
Die ersten Bildergeschichten von Wilhelm Busch erschienen ab 1859 als Einblattdrucke. In Buchform wurden sie erstmals 1864 unter dem Titel Bilderpossen veröffentlicht. Schon seit den 1870er Jahren in ganz Deutschland berühmt, galt er bei seinem Tod dank seiner äußerst volkstümlichen Bildergeschichten als «Klassiker des deutschen Humors». Als Pionier des Comics schuf er bis heute populäre Werke. Oft griff er darin satirisch die Eigenschaften bestimmter Typen oder Gesellschaftsgruppen auf, etwa die Selbstzufriedenheit und Doppelmoral des Spießbürgers oder die Frömmelei von Geistlichen und Laien. Viele seiner Zweizeiler sind im Deutschen zu festen Redewendungen geworden, zum Beispiel «Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr» oder «Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich». Seine vom Stil Heines und Schopenhauers beeinflusste Lyrik und Prosadichtung stießen beim Publikum, das mit seinem Namen komische Bildergeschichten verband, auf Unverständnis. Dass seine künstlerischen Hoffnungen enttäuscht wurden und er übersteigerte Erwartungen an sich selbst zurücknehmen musste, sublimierte er mit Humor. Dies spiegelt sich in seinen Bildergeschichten wieder.
Empörung, Revolte, Emotion
Ziel dieses Sammelbandes ist es, die Relevanz der aktuellen Emotionsforschung für die verschiedenen Ansätze und Teilbereiche der Germanistik aufzuzeigen. Besonders berücksichtigt wird dabei eine bestimmte Emotion: die Empörung als individueller und als kollektiver Affekt, als ein Gefühl, aber auch als ein Ereignis, das im Phänomen der individuellen und kollektiven Revolte gipfeln kann. Das Spannungsverhältnis zwischen Behauptung und Zerstörung (bzw. Positivität und Negativität) bei Empörung und Revolte gibt zumindest Anlass zur Besprechung von zwei Grundthemen der neueren Affekttheorien: den komplexen Verbindungen zwischen persönlichen Werturteilen und emotionaler Intensität, und dem Verhältnis zwischen Emotionen und der «Virtualität», d.h. der Menge aufkeimender, unvollkommener Entwicklungen, durch welche die Futurität in der Gegenwart verankert, aber auch teilweise gefangen ist.
Intertextualität und Parodie in Ovids Remedia amoris
Ovids Remedia amoris zeichnen sich durch die produktive Rezeption paradigmatischer Intertexte und literarischer Gattungen (Lehrgedicht, Satire, Jambus) aus. Die Autorin zeigt, wie intertextuell-parodistisch auf Lukrez' Diatribe gegen die Liebesleidenschaft in De rerum natura 4, Horaz' Satiren und Epoden und Catulls Carmina referiert wird. Ferner wird dargestellt, inwiefern diesen Prätexten eine für die inhaltliche und strukturelle Komposition der Remedia werk-konstitutive Funktion zukommt. Der Untersuchung werden bestehende Perspektiven auf Parodie und Intertextualität zugrunde gelegt. Darauf aufbauend entwickelt die Autorin das visualisierende Pyramidenmodell der Intertextualität, das für die Untersuchung der Remedia und für weitere Studien eingesetzt werden kann. Das Buch richtet sich an interessierte Studierende, Dozierende und Literaturwissenschaftler:innen der Latinistik und klassischen Philologie.
Erzählungen aus 1001 Nacht - 4. Band
Wir lesen im 4. Band die Geschichten der Einhundertfünfundneunzigste bis zweihundertneunundsechzigste Nacht. Die Erzählungen aus Tausendundeine(r) Nacht sind eine Sammlung morgenländischer Texte und zugleich ein Klassiker der Weltliteratur. Typologisch handelt es sich um eine Rahmenerzählung mit Schachtelgeschichten. Aus Sicht der frühesten arabischen Leser hatte das Werk den Reiz der Exotik, es stammt für sie aus einem mythischen «Orient». Das Strukturprinzip der Rahmengeschichte sowie einige der enthaltenen Tierfabeln weisen auf einen indischen Ursprung hin und stammen vermutlich aus der Zeit um 250. So wird zwar ein indischer Ursprung vermutet, aber dass der Kern der Erzählungen aus Persien stammt, kann nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass zwischen dem indischen und persischen Kulturraum zu jener Zeit enge Beziehungen bestanden.
Illustrierte Geschichten - 3. Band
Die ersten Bildergeschichten von Wilhelm Busch erschienen ab 1859 als Einblattdrucke. In Buchform wurden sie erstmals 1864 unter dem Titel Bilderpossen veröffentlicht. Schon seit den 1870er Jahren in ganz Deutschland berühmt, galt er bei seinem Tod dank seiner äußerst volkstümlichen Bildergeschichten als «Klassiker des deutschen Humors». Als Pionier des Comics schuf er bis heute populäre Werke. Oft griff er darin satirisch die Eigenschaften bestimmter Typen oder Gesellschaftsgruppen auf, etwa die Selbstzufriedenheit und Doppelmoral des Spießbürgers oder die Frömmelei von Geistlichen und Laien. Viele seiner Zweizeiler sind im Deutschen zu festen Redewendungen geworden, zum Beispiel «Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr» oder «Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich». Seine vom Stil Heines und Schopenhauers beeinflusste Lyrik und Prosadichtung stießen beim Publikum, das mit seinem Namen komische Bildergeschichten verband, auf Unverständnis. Dass seine künstlerischen Hoffnungen enttäuscht wurden und er übersteigerte Erwartungen an sich selbst zurücknehmen musste, sublimierte er mit Humor. Dies spiegelt sich in seinen Bildergeschichten wieder.