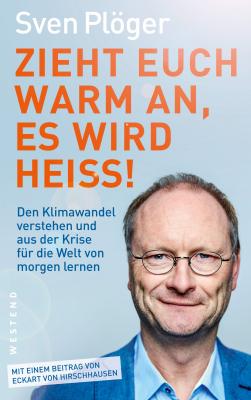Zieht euch warm an, es wird heiß!. Sven Plöger
Читать онлайн.| Название | Zieht euch warm an, es wird heiß! |
|---|---|
| Автор произведения | Sven Plöger |
| Жанр | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Серия | |
| Издательство | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9783864897733 |
Und die Dynamik dieser Prozesse verändert sich, wenn etwa der Mensch durch sein Zutun in die Zusammensetzung der Atmosphäre eingreift. Wenn er Chlor in die Luft pustet, das dort ursprünglich nicht vorhanden war, dann verändert sich in der Folge etwas – chemische Reaktionen ließen das Ozonloch entstehen. Wenn immer mehr Kohlendioxid (häufig mit CO2 abgekürzt) in die Atmosphäre gelangt, so wird diese wärmer und in der Folge verändern sich die Wetterabläufe, unter deren Bedingungen wir uns vor Hunderten oder Tausenden Jahren angesiedelt haben und an die wir bis heute gewöhnt sind. Das kann man etwa an Kapstadt beobachten. Der Metropole geht durch den ausbleibenden Regen als einer Folge des Klimawandels das Wasser aus und das bedeutet aus heutiger Klimasicht schlicht und einfach, dass die Stadt an der falschen Stelle steht. So leicht es sich schreibt, so tragisch ist dieser Umstand für die Menschen dort – aber natürlich nur für den ärmeren Teil der Bevölkerung, denn die reichen Bürger bohren sich tiefe Privatbrunnen und sind deshalb noch gut mit Wasser versorgt. Das Wort »noch« spielt allerdings eine große Rolle, denn der Grundwasserspiegel sinkt schnell. Und dieses Problem ist nicht etwa den entlegenen Regionen dieser Welt zu eigen, denn auch in Deutschland bekommen wir gerade ein veritables Problem mit der Grundwasserneubildung.
Die Klimaforschung – es seien noch mal die zutreffenden Prognosen erwähnt – ist sich heute sicher, dass der Mensch erhebliche Auswirkungen auf das Klimageschehen hat und stellt klar fest, dass die derzeitigen rasanten globalen Veränderungen unseres Klimas, die wir unbestritten beobachten können, mit rein natürlichen Prozessen nicht erklärbar sind. Hierin stimmen 99 Prozent der Wissenschaftler überein – eine Einigkeit, die sich über mehrere Jahrzehnte intensiver Forschungsarbeit mit zigtausenden Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften herausgebildet hat. So sicher, wie heute vernunftbegabte Menschen sagen, dass zwei plus zwei vier ergibt und dass die Erde eine Kugel ist, können wir auch sagen, dass der Mensch das Klima maßgeblich beeinflusst. Der letzte Satz schließt natürlich nicht aus, dass es Menschen gibt, die in Gänze an der Mathematik zweifeln, und lässt auch zu, dass heute in etwa 3 500 Menschen der »Flat Earth Society« anhängen und von der Scheibenerde überzeugt sind. An dieser Stelle müssen Sie vielleicht lachen, weil es so ein offensichtlicher Unsinn ist. Lachen befreit und glücklicherweise denken die wenigsten Menschen so. Würden wir alle in weltfremdem Irrsinn durch die Welt geistern, wären wir schon vor langer Zeit ausgestorben. Die natürliche Selektion ist ein mächtiges Korrektiv, wenn man die Realität falsch einschätzt.
Aber lacht man auch sofort über jemanden, der anzweifelt, dass der Mensch maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich ist? Weit gefehlt! Das Thema Klimawandel wird in der Öffentlichkeit und – wie man an manchen Staatschefs sehen kann – auch in der Politik durchaus kontrovers diskutiert. Warum aber folgen wir bei diesem Thema oftmals nicht den eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Was berechtigt uns, die Klimaforschung trotz ihrer sichtbaren Qualität offen und häufig ohne eigene physikalische Kenntnis anzuzweifeln?
Das hat mit kognitiver Dissonanz zu tun. Kognitionen sind die Erkenntnisse eines Individuums über die Realität, nachdem es die Eindrücke verarbeitet hat, die es aus unserer Wahrnehmungsrealität erhält. Da es davon aber viele gibt, können sie auch zueinander in Widerspruch stehen, und dann entsteht in uns eine Dissonanz, ein Spannungszustand. Diesen empfinden wir als nicht gerade schön, aber wir halten ihn aus, weil wir die widersprüchlichen Kognitionen am Ende unterschiedlich gewichten, um eine Handlung oder eine Haltung vor uns selbst und anderen begründen zu können. Diese Abwägung kann je nach Kontext oder den Menschen, die uns gerade umgeben, von Moment zu Moment unterschiedlich ausfallen. Ein bekanntes Beispiel für kognitive Dissonanz ist der kettenrauchende Lungenfacharzt. Den dürfte es eigentlich nicht geben, denn er hat eine positive Einstellung zum Rauchen, obwohl er sehr genau um dessen Schädlichkeit weiß. Um die Dissonanz kleinzuhalten, wird er vielleicht selektiv auf Helmut Schmidt hinweisen, der trotz intensiven Rauchens sehr alt wurde. Möglicherweise wird er auch einige Studien als nicht so glaubwürdig abtun oder sie gleich komplett ignorieren, nur um am Ende mit nicht allzu schlechtem Gewissen zu rauchen – und seinen Patienten gleichzeitig intensiv davon abzuraten.
Übertragen wir dieses Konzept auf die Klimaforschung. Wenn man ihren Ergebnissen zustimmt, stimmt man automatisch auch der Aussage zu, dass das ungebremste Wirtschaftswachstum mit der Folge der bisher ungezügelten Ausbeutung der Natur in gefährliche Zustände führt. Sir Nicholas Stern, britischer Ökonom und von 2000 bis 2003 Chefökonom der Weltbank, hat das 2007 klar formuliert: »Der Klimawandel ist das Ergebnis des größten Marktversagens, das die Welt je gesehen hat.« Genau dieses Wirtschaftswachstum hat uns, zusammen mit technologischem Fortschritt, aber auch erlaubt, seit Ende des Krieges einen beachtlichen Wohlstand zu erlangen. Dass wir heute so leben, wie wir leben, gefällt den meisten Menschen. Und jetzt: Schauen Sie auf beide Aussagen gleichzeitig. Spüren Sie es? Das ist die kognitive Dissonanz. Ich kann nicht das, was ich gut finde, gleichermaßen auch schlecht finden. Um einer Konsonanz, sprich einem inneren Gleichgewicht möglichst nahezukommen, kann ich nun entweder die Erkenntnisse der Klimaforschung als besonders bedeutend einstufen oder sie eben anzweifeln. In beiden Fällen gewinnt eine der widerstreitenden Kognitionen die Oberhand und der innere Spannungszustand wird schwächer.
Bewertet man die Erkenntnisse der Klimaforschung als korrekt, führt das automatisch dazu, dass man seine Haltung zu Klimawandel und Umwelt und damit letztendlich auch sein Verhalten ändern muss. Weist man sie hingegen zurück – was umso einfacher ist, je weniger Ahnung man von den physikalischen Prozessen in der Atmosphäre hat – muss man beides nicht tun. Kurz: Je nach Gewichtung kommt unter dem Strich entweder eine konsequente und damit mühsame Verhaltensänderung heraus oder die Gelegenheit, alte Gewohnheiten unbeirrt fortzuführen. Letzteres – wir sind nun mal Gewohnheitstiere – fällt erkennbar leichter. Um die erste, anstrengendere Variante zu wählen, muss man also entweder wirklich inhaltlich überzeugt sein oder eine konkrete Bedrohung spüren.
Die Geburt klimaskeptischer »Argumente«
Der kognitive Wettbewerb zwischen Wissen und Wunsch legt das Fundament dafür, dass die wissenschaftliche und die öffentliche Diskussion völlig unterschiedlich verlaufen. Weil der Wunsch des »schönen Lebens« aber in der Kraft der Argumentation gegen den bedrohlichen Klimawandel – auch wenn es zweifellos sehr ehrlich wäre, diesen Wunsch auszudrücken – ganz schön schwach dasteht, versucht man der öffentlichen Diskussion einen »fachlichen Anstrich« und damit eine Gleichberechtigung zur akademischen Diskussion zu geben. Genau das ist die Stelle, an der die außerhalb der Wissenschaft typischerweise vorgetragenen »Kritikerargumente« ihren Weg in die »große weite Welt« finden und hier seit Jahren für Verunsicherung und teilweise Diskreditierung der Klimawissenschaft sorgen. Deshalb werden Beiträge dieser Art zur »Erweiterung unseres Horizonts« später im Buch aufgegriffen und jeweils hinsichtlich ihres physikalischen Inhaltes geprüft. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Klassiker: »Es gibt nur 0,04 Prozent CO2 in der Atmosphäre – wie soll das denn so einen Klimawandel verursachen?« Das klingt gut und verunsichert viele auf vermeintlicher Sachebene, weil 0,04 Prozent nach wenig klingt. Der einfache Denkfehler: »Wenig macht wenig!« Das Gegenteil vom berühmten Spruch »Viel hilft viel«. Und beides stimmt eben nicht. Doch dazu später mehr im Kapitel »Kritischen Äußerungen begegnen und daraus lernen«. An dieser Stelle sei dazu nur Kurt Tucholskys sehr kluger Satz zitiert: »Plausibilität ist der größte Feind der Wahrheit.«
Dieser gefühlt fachliche Ansatz der Argumentation ist aus zwei Gründen sehr erfolgreich: Erstens, weil sich viele von uns eine Absolution für ihr nicht klimafreundliches Verhalten wünschen und hinter solchen Behauptungen Schutz suchen können, und zweitens, weil wir – Pisa lässt grüßen – zunehmend an kollektiver physikalischer Ignoranz leiden. »Physik« und »Phantasie« fangen zwar beide mit »Ph« an, enden aber doch völlig anders. Das scheint so manchem zu entgehen und darum klingt völliger Unsinn in vielen Ohren leider absolut vernünftig. Aber anstatt diesen Umstand zu betrauern, orientieren