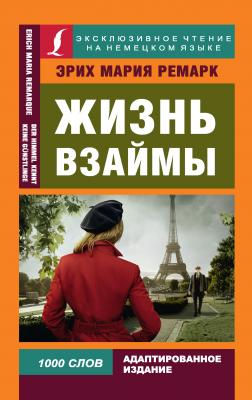Жизнь взаймы / Der Himmel kennt keine Günstlinge. Эрих Мария Ремарк
Читать онлайн.| Название | Жизнь взаймы / Der Himmel kennt keine Günstlinge |
|---|---|
| Автор произведения | Эрих Мария Ремарк |
| Жанр | Зарубежная классика |
| Серия | Эксклюзивное чтение на немецком языке |
| Издательство | Зарубежная классика |
| Год выпуска | 2018 |
| isbn | 978-5-17-108508-7 |
Er schüttelte es ab. »Es kommt darauf an«, sagte er zu Lillian. »Dieser Mann war sinnlos in eine Frau verliebt, die ihn mit jedem Mechaniker betrog. Und er war ein begeisterter Rennfahrer, der aber nie über den Durchschnitt hinausgekommen wäre. Alles, was er vom Leben wollte, waren Siege in großen Rennen und die Frau. Er starb, bevor er über beides die Wahrheit herausfand – und er starb auch, ohne zu wissen, daß die Frau ihn nicht mehr sehen wollte, weil er amputiert war. Das meine ich mit Glück.«
»Vielleicht hätte er trotzdem noch gerne gelebt!«
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Clerfayt, plötzlich irritiert. »Aber ich habe Menschen elender sterben sehen. Sie nicht auch?«
»Ja«, sagte Lillian hartnäckig. »Aber alle hätten gern noch gelebt.«
Clerfayt schwieg. Was rede ich da nur? dachte er. Und wozu? Aber rede ich nicht, um mich selbst von etwas zu überzeugen, was ich nicht glaube? Diese harte, kalte, metallische Stimme von Ferrers Freundin am Telefon!
»Wollen wir darauf trinken?«
»Worauf?«
»Auf nichts. Auf ein bißchen Courage vielleicht.«
»Ich bin der Courage müde«, sagte Lillian. »Und des Trostes auch. Erzählen Sie mir lieber, wie es unten aussieht. Auf der anderen Seite der Berge.«
»Trostlos. Nichts als Regen. Seit Wochen.«
Sie stellte ihr Glas langsam auf den Tisch zurück.
»Regen!« Sie sagte es, als sagte sie: Leben. »Hier hat es seit Oktober nicht mehr geregnet. Nur geschneit. Ich habe schon fast vergessen, wie Regen aussieht«
Es schneite, als sie herauskamen. Sie fuhren die Serpentinen hinauf.
Die Straße war still. Schweigend fuhren sie und hielten vor dem Seiteneingang des Sanatoriums.
Sie öffnete die Tür. »Danke«, murmelte sie. »Und verzeihen Sie – ich war keine gute Gesellschaft. Aber ich konnte nicht allein sein heute abend.«
»Ich auch nicht.«
»Sie? Warum Sie nicht?«
»Aus demselben Grund wie Sie. Ich habe es Ihnen erzählt. Das Telefon aus Monte Carlo.«
»Aber Sie sagten doch, das sei ein Glück.«
»Es gibt verschiedene Arten von Glück. Und man sagt manches.« Clerfayt griff in die Tasche seines Mantels.
»Hier ist der Kirsch, den Sie dem Hausknecht versprochen haben.
Und hier die Flasche Wodka für Sie. Gute Nacht.«
3
Als Clerfayt erwachte, sah er einen bewölkten Himmel und hörte den Wind.
»Föhn«, sagte der Kellner. »Der warme Wind, der müde macht. Man fühlt ihn immer schon vorher in den Knochen. Die Bruchstellen[16] schmerzen.«
»Sind Sie Skiläufer?«
»Nein«, sagte der Kellner. »Ich habe nur noch einen Fuß. Aber Sie glauben nicht, wie der, der mir fehlt, bei diesem Wetter weh tut.«
Clerfayt beschloß, das Skilaufen zu verschieben. Er war ohnehin noch müde.Er hatte auch Kopfschmerzen. Der Kognak gestern nacht, dachte er. Warum hatte er weitergetrunken, nachdem er das sonderbare Mädchen mit seiner Mischung aus Weltschmerz und Lebensgier zum Sanatorium gebracht hatte? Merkwürdige Menschen hier oben. Ich war auch einmal so ähnlich, dachte er. Vor tausend Jahren. Habe mich gründlich geändert. Und was kam noch? Wie lange konnte er noch Rennen fahren? Was erwartete ihn noch?
Der Weltschmerz steckt an, dachte er und stand auf. Mitte des Lebens, ohne Ziel und ohne Halt. Er zog seinen Mantel an und entdeckte darin einen schwarzen Samthandschuh. Er hatte ihn gestern auf dem Tisch gefunden, als er allein in die Bar zurückgekommen war. Lillian Dunkerque mußte ihn vergessen haben. Er steckte ihn in die Tasche, um ihn später im Sanatorium abzugeben.
Er war eine Stunde durch den Schnee gegangen, als er, ein kleines Gebäude entdeckte. Er blieb stehen. »Was ist denn das da?« fragte er einen jungen Jungen, der vor einem Laden Schnee wegschaufelte. »Das Krematorium, mein Herr.«
Clerfayt hatte sich also nicht geirrt.
»Hier?« sagte er. »Wozu habt ihr denn hier ein Krematorium?«
»Für die Hospitäler natürlich. Die Toten.«
»Dazu brauchen sie ein Krematorium? Sterben denn so viele?«
»Jetzt nicht mehr so viele, mein Herr. Aber früher gab es hier viele Tote. Wir haben hier lange Winter. Ein Krematorium ist da viel praktischer. Wir haben unseres hier schon fast dreißig Jahre.«
»Es ist auch billiger. Die Leute wollen jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben für den Leichentransport. Früher war das anders.«
»Das glaube ich.«
»Mein Vater war ein Leichenbegleiter«, sagte der Bursche.
»Und dann kam das Krematorium. Anfangs war es nur für
Leute ohne Religion, aber jetzt ist es sehr modern geworden.«
»Das ist es«, bestätigte Clerfayt. »Nicht nur hier.«
Der Bursche nickte. »Die Leute haben keinen Respekt mehr vor dem Tode, sagte mein Vater. Die beiden Weltkriege haben das verursacht; es sind zu viele Menschen umgekommen. Immer gleich Millionen. Das hat seinen Beruf ruiniert, sagt mein Vater.«
»Was macht Ihr Vater jetzt?«
»Jetzt haben wir das Blumengeschäft hier.« Der Bursche zeigte auf den Laden, vor dem sie standen. »Wenn Sie irgend etwas brauchen, mein Herr, wir sind billiger als die Räuber im Dorf. Und wir haben manchmal herrliche Sachen. Gerade heute morgen ist eine frische Sendung gekommen. Brauchen Sie nichts?«
Clerfayt dachte nach. Blumen? Warum nicht? Er trat in den Laden.
Clerfayt sah eine Vase mit weißem Flieder und einen langen Zweig flacher, weißer Orchideen. »Sehr frisch!« sagte der kleine Mann. »Heute erst angekommen. Hält sich mindestens drei Wochen. Es ist eine seltene Art.«
»Sind Sie Orchideenkenner?«
»Ja, mein Herr. Ich habe viele Sorten gesehen. Auch im Ausland.«
»Packen Sie es ein«, sagte er und zog den schwarzen Samthandschuh Lillians aus der Tasche. »Legen Sie dies dazu. Haben Sie einen Briefumschlag und eine Karte?«
Er ging zurück zum Dorf.
Er trat in eine Kneipe. »Einen doppelten Kirsch.«
»Nehmen Sie einen Pflümli«, sagte der Wirt. »Wir haben einen ganz hervorragenden.«
»Gut. Geben Sie mir einen doppelten.«
Der Wirt schenkte das Glas bis zum Rande voll. Clerfayt trank es leer.
»Geben Sie mir noch einen«
Er ging zur Garage, um nach Giuseppe zu sehen. Der Wagen stand in dem großen, dämmerigen Raum ziemlich weit hinten, mit dem Kühler zur Wand.
Clerfayt blieb am Eingang stehen. Er sah im Halbdunkel jemand am Steuer sitzen. »Spielen Ihre Lehrlinge hier Rennfahrer?« fragte er den Besitzer der Garage, der mit ihm gekommen war.
»Das ist kein Lehrling. Er sagt, er wäre ein Freund von Ihnen.« Clerfayt sah schärfer hin und erkannte Hollmann.
»Stimmt das nicht?« fragte der Besitzer.
»Doch, es stimmt. Wie lange ist er schon hier?«
»Noch nicht lange. Fünf Minuten.«
»Ist er das erste Mal hier?«
»Nein; er war heute morgen schon einmal da – aber nur für einen Augenblick.«
Hollmann saß mit dem Rücken zu Clerfayt am Steuer Giuseppes. Es war
Место перелома