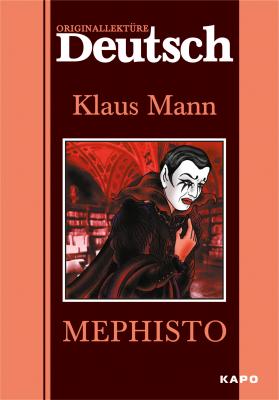Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком языке. Клаус Манн
Читать онлайн.| Название | Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком языке |
|---|---|
| Автор произведения | Клаус Манн |
| Жанр | Литература 20 века |
| Серия | Originallektüre Deutsch |
| Издательство | Литература 20 века |
| Год выпуска | 2007 |
| isbn | 5-89815-850-2 |
Es war Höfgens schlaue Gewohnheit, wie ein nervöser kleiner Sturmwind in Schmitzens Büro zu fahren, wenn er Vorschuss oder Gagenerhöhung wollte. Zu solchen Anlässen spielte er den übermütig Launischen und Kapriziösen, und er wusste, dass der ungeschickte dicke Schmilz verloren war, wenn er ihm die Haare zauste und den Zeigefinger munter in den Bauch stieß. Da es sich um die Tausend-Mark-Gage handelte, hatte er sich ihm sogar auf den Schoß gesetzt: Schmilz gestand es unter Erröten.
„Das sind Albernheiten!“ Kroge schüttelte ärgerlich das versorgte Haupt. „Überhaupt ist Höfgen ein grundalberner Mensch. Alles an ihm ist falsch, von seinem literarischen Geschmack bis zu seinem sogenannten Kommunismus. Er ist kein Künstler, sondern ein Komödiant.“
„Was hast du gegen unseren Hendrik?“ Frau von Herzfeld zwang sich zu einem ironischen Ton; in Wahrheit war ihr keineswegs nach Ironie zumute, wenn sie von Höfgen sprach, für dessen geübte Reize sie nur zu empfänglich war, „Er ist unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren.“
„Ich bin gar nicht so besonders stolz auf ihn“, sagte Kroge. „Er ist doch nicht mehr als ein routinierter Provinzschauspieler, und das weiß er übrigens im Grunde selbst ganz genau.“
Schmilz fragte: „Wo steckt er denn heute abend?“ – worauf Frau von Herzfeld leise durch die Nase lachte: „Er hat sich in seiner Garderobe hinter einem Paravent versteckt – der kleine Bock hat es mir erzählt. Er ist immer furchtbar aufgeregt und eifersüchtig, wenn Berliner Gäste da sind. So weit wie die werde er es niemals bringen, sagt er dann – und versteckt sich hinter einem Paravent, vor lauter Hysterie. Die Martin bringt ihn wohl besonders aus der Fassung, das ist so eine Art von Hassliebe bei ihm. Heute abend soll er schon einen Weinkrampf gehabt haben.“
„Da seht ihr seinen Minderwertigkeitskomplex!“ rief Kroge und schaute triumphierend um sich. „Oder vielmehr: dass er im Grunde irgendwo die richtige Einschätzung hat für sich selber.“
Die drei saßen in der Theaterkantine, die, nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters, kurz „H. K.“ genannt wurde.
Drunten, im Theater, spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit des ephebischen Körpers und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren und Frau von Herzfeld hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen.
„Das Ensemble, das sie sich mitgebracht hat, ist ja wirklich unter jeder Kritik“, stellte Kroge verächtlich fest.
„Was wollen Sie?“ meinte Schmilz. „Wie soll sie jeden Abend ihre tausend Mark verdienen, wenn sie sich auch noch teure Leute mit auf die Reise nimmt?“
„Aber sie selber wird immer besser“, sagte die kluge Herzfeld. „Sie kann sich jede Manieriertheit leisten. Sie kann wie ein geisteskrankes Baby sprechen: Sie bezwingt.“
„Geisteskrankes Baby ist nicht schlecht“, lachte Kroge. „Man scheint unten fertig zu sein“, fügte er hinzu, mit einem Blick durchs Fenster. Die Leute kamen den gepflasterten Weg herauf, der vom Theater, an der Kantine vorbei, zu dem Tor führte, durch das man auf die Straße trat.
Nach und nach füllte sich die Kantine. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Väterchen Hansemann, der Kantinenbesitzer, war für das Ensemble eine beinah ebenso bedeutungsvolle Persönlichkeit wie Schmilz, der geschäftliche Direktor. Von Schmilz konnte man Vorschuss bekommen, wenn er sich gerade in gnädiger Laune befand; bei Hansemann aber musste man anschreiben lassen, wenn in der zweiten Monatshälfte die Gage aufgebraucht und ein Vorschuss nicht genehmigt worden war. Alle standen bei ihm in der Kreide; man behauptete, dass Höfgen ihm mehr als hundert Mark schuldig war.
Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung; nur darüber, dass sie entschieden zuviel Geld verdiente, waren alle sich einig.
Die Motz erklärte: „An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde“ – wozu ihr Freund Petersen grimmig nickte. Petersen war Väterspieler mit dem Ehrgeiz zum Heroischen; er bevorzugte Könige oder adlige alte Haudegen in historischen Stücken. Leider war er etwas zu klein und dick für diese Partien – was er auszugleichen suchte durch eine stramme und kampfeslustige Haltung. Zu seinem Gesicht, das den Ausdruck falscher Biederkeit zeigte, hätte ein grauer Schifferbart gepasst; da er fehlte, wirkte seine Miene ein wenig kahl, mit der langen, rasierten Oberlippe und den sehr blauen, ausdrucksvoll blitzenden, zu kleinen Augen. Die Motz liebte ihn mehr als er sie: das wussten alle. Da er genickt hatte, wandte sie sich nun direkt an ihn, um in einem intimen und bedeutungsvollen Ton zu sagen: „Nicht wahr, Petersen: über diese Misswirtschaft haben wir schon häufig miteinander gesprochen?“ Er bestätigte treuherzig: „Gewiss doch, Frau!“ und blinzelte Rahel Mohrenwitz zu, die aufgemacht war als das perverse und dämonische junge Mädchen: mit schwarzen Ponys bis zu den rasierten Augenbrauen und einem großen, schwarzgerandeten Monokel im Gesicht, das übrigens kindlich, pausbäckig und völlig ungeformt war.
„In Berlin wirken die Martinschen Mätzchen vielleicht“, sprach die Motz resolut. „Aber unsereinem kann sie nichts vormachen, wir sind schließlich lauter alte Theaterhasen.“ Sie blickte beifallheischend um sich. Ihr Fach war die komische Alte; zuweilen durfte sie auch reife Salon-damen spielen. Sie lachte gern, viel und laut, wobei sie scharfe Falten um den Mund bekam, in dessen Innerem Gold funkelte. Im Augenblick freilich zeigte sie eine würdevoll ernste, beinah zornige Miene.
Rahel Mohrenwitz sagte, wobei sie hochmütig mit ihrer langen Zigarettenspitze spielte: „Niemand kann schließlich leugnen, dass die Martin irgendwo eine enorm starke Persönlichkeit ist. Was sie auf der Bühne auch macht: immer ist sie unerhört intensiv da – ihr versteht, was ich meine…“ Alle verstanden es; die Motz aber schüttelte missbilligend den Kopf, während die kleine Angelika Siebert mit ihrem hohen, schüchternen Stimmchen erklärte: „Ich bewundere die Martin. Es geht eine zauberhafte Kraft von ihr aus, finde ich…“ Sie wurde sehr rot, weil sie einen so langen und gewagten Satz vorgebracht hatte. Alle sahen mit einer gewissen Rührung zu ihr hin. Die kleine Siebert war reizend. Ihr Köpfchen mit dem kurzgeschnittenen, links gescheitelten blonden Haar glich dem eines dreizehnjährigen Buben. Ihre hellen und unschuldigen Augen wurden dadurch nicht weniger anziehend, dass sie kurzsichtig waren: manche fanden, dass gerade die Art, auf die Angelika beim Schauen die Augen zusammenkniff, ihren besonderen Charme ausmache.
„Unsere Kleine schwärmt wieder einmal“, sagte der schöne Rolf Bonetti und lachte etwas zu laut. Er war jenes Mitglied des Ensembles, das die meisten Liebesbriefe aus dem Publikum erhielt: daher sein stolzer, müder, vor lauter Blasiertheit beinah angewiderter Gesichtsausdruck. Der kleinen Angelika gegenüber jedoch war er der Werbende: schon seit längerem bemühte er sich um sie. Auf der Bühne durfte er sie oft in den Armen halten, das brachte sein Rollenfach mit sich. Im übrigen aber blieb sie spröde. Mit einer wunderlichen Hartnäckigkeit verschenkte sie ihre Zärtlichkeit nur dorthin, wo nicht die mindeste Aussicht bestand, dass man sie erwiderte oder auch nur wünschte. Rührend und begehrenswert, wie sie war, schien sie ganz dafür gemacht, viel geliebt und sehr verwöhnt zu werden. Der sonderbare Eigensinn ihres Herzens aber ließ sie kühl und spöttisch bleiben vor Rolf Bonettis stürmischen Beteuerungen, und ließ sie bitterlich weinen über die eisige Geringschätzung, die Hendrik Höfgen ihr gegenüber an den Tag legte.
Rolf Bonetti sagte kennerhaft: „Als Frau kommt diese Martin jedenfalls gar nicht in Frage: ein unheimlicher Zwitter – sicher hat sie so etwas wie Fischblut in den Adern.“
„Ich finde sie schön“, sagte Angelika, leise aber entschlossen. „Sie ist die schönste Frau, finde ich.“ Schon standen ihr die Augen voll Tränen: Angelika weinte häufig, auch ohne besonderen Anlass. Träumerisch sagte sie noch: „Es